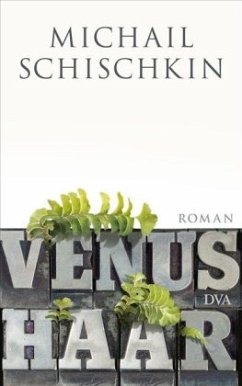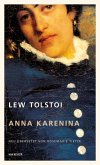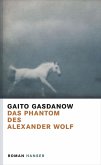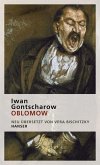Warum haben Sie Asyl beantragt? Diese Frage muss der namenlose Erzähler mehrfach täglich ins Russische übersetzen. Er arbeitet als Dolmetscher für die Schweizer Einwanderungsbehörde bei Vernehmungen von Flüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion. Doch beim Übersetzen des fremden Leids legt sich seine eigene Lebensgeschichte wie eine zweite Schicht um die Worte. Auch er ist ein Emigrant, der sich nach denen sehnt, die er nicht mehr um sich hat: nach seiner Frau und seinem Kind. Und plötzlich treten dem Dolmetscher neben seinen eigenen Erinnerungen und Gefühlen auch Geschichten aus anderen Welten und Zeiten entgegen. Auf faszinierende Weise erzählt Schischkin ein Jahrhundert russischer Geschichte und bettet außerdem das Leben des Dolmetschers durch Verweise in einen Kosmos der gesamten Weltkultur ein. "Venushaar" ist eine vielstimmige Parabel auf das verlorene Paradies - kunstvoll komponiert, stilistisch virtuos.

Die Figuren suchen nach Identität, die Leser nach einer Struktur: Der preisgekrönte Roman "Venushaar" von Michail Schischkin stolpert über seine Ambition.
In jedem Batzen Spucke fliegt ein Universum" - und irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Wenn ein Schriftsteller eine derart holistische Weltsicht in Literatur verwandelt, darf man ein "komplexes Meisterwerk" erwarten. Im Fall des in der Schweiz lebenden Russen Michail Schischkin waren sich die Juroren für den wichtigsten russischen Literaturpreis, Das Große Buch 2006, nahezu einig. Jetzt hat es der jüngste Roman des 1961 in Moskau geborenen Schriftstellers auch hierzulande auf die Shortlist des Internationalen Literaturpreises des Berliner Hauses der Kulturen der Welt geschafft. Was immer man über das Buch hört oder liest, das Komplexe scheint sein hervorstechendes Merkmal zu sein. Doch ist Komplexität ein Qualitätsmerkmal an sich?
Schon der Titel ist Programm: Frauenhaarfarn, auch Venushaar genannt, ist eine wuchernde Pflanze, die mühelos Felsen und Mauerwerk durch- und überwächst. So ähnlich ist es auch mit den Handlungslinien in Schischkins Roman. Ein bei der schweizerischen Asylbehörde angestellter Russischdolmetscher, selbst Einwanderer aus Russland und wohl das Alter Ego des Autors, erzählt in düsterem Dostojewski-Ton vom inquisitorischen Frageprozedere der Behörde und wie Asylsuchende versuchen, sich durch dieses perfide bürokratische Labyrinth zu lavieren. Er weiß, dass ihre Geschichten oft nicht stimmen, doch schließlich, so meint er, sei alles, was erzählt wird, irgendwann und irgendwo irgendeinem Menschen passiert und legitimiere somit zum staatlich sanktionierten Erbarmen.
Daneben quält sich der Dolmetsch mit seiner an einer vertrackten Dreierbeziehung - Tristan, er und Isolde! - gescheiterten Ehe und hat in seiner einsamen Zürcher Wohnung Sehnsucht nach Frau und Sohn. Darüber hinaus mutiert er selbst zum Objekt eines quälenden Frage-und-Antwort-Spiels. In seinen Pausen liest er in der "Anabasis" von Xenophon über den Krieg des Kyros gegen Artaxerxes. In einem kalten Gebirge treffen, höchst intertextuell, dessen Armeen auf tschetschenische Vertriebene, die von Stalin der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt und schließlich deportiert wurden: Feuer im Schnee, elende Menschen, Listen von Toten, und alle wollen zum rettenden Meer.
Schließlich fließen in die ambitionierte Polyphonie des Romans Tagebuchaufzeichnungen der russischen Gesangsikone Isabella Jurjewa aus den Jahren des Ersten Weltkrieges und der Nachrevolutionszeit ein. Die 1899 geborene, vom Volke umjubelte Diva und hochdekorierte Staatskünstlerin der Sowjetunion starb im Jahr 2000, alt wie Methusalem und ziemlich vergessen, in Moskau. Immer mehr dominieren ihre recht banalen Backfischphantasien und Alltagsweisheiten - "Je ärger das Unglück der einen, desto entschiedener müssen die anderen auf ihrem Glück bestehen" - die Tonlage des Buches.
Michail Schischkin ist ein Sprachvirtuose, dessen surreale, apokalyptische Szenarien an die Filme seines Landsmannes Andrei Tarkowski erinnern. Andreas Tretner hat diese Sprachkraft meisterhaft ins Deutsche übertragen. Dennoch erweist sich die Lektüre als ermüdender Kraftakt. Die umfangreichen, umsichtigen Anmerkungen des Übersetzers zu den zahllosen historischen und literarischen Anspielungen erleichtern die Rezeption nur bedingt. Denn allzu oft erschöpft sich die postmoderne Komplexität im Manierismus - und der Leser verliert in der Kakophonie der Stimmen die Orientierung.
SABINE BERKING.
Michail Schischkin: "Venushaar". Roman. Aus dem Russischen von Andreas Tretner.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 554 S., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ziemlich anstrengend findet Rezensentin Christiane Pöhlmann diesen Text des russischen Autors Michail Schischkin, der sie für ihre Lektüremühen letztendlich auch nicht entschädigte. Ein Labyrinth aus Motiven, Szenen und Momenten errichtet Schischkin mit diesem Text, unzählige Figuren aus Mythos und Literatur treffen aufeinander, es geht um russische Flüchtlinge in der Schweiz, Paradiese und Nebenparadiese, Daphnis in der Moskauer Metro und Agatha Christies "Zehn kleine Negerlein". Aber wird das je mehr als Selbstzweck? Die Rezensentin ist sich da nicht sicher. Zur gekonnten Verflechtung all seiner Geschichten fehle dem Buch der "erzählerische Drive", immer behalte in diesem "literarischen Wimmelbild" die Form über den Inhalt die Oberhand. Negativ zu Buche schlagen für Pöhlmann auch Schischkins Hang zum Esoterischen und ein "ärgerliches Frauenbild".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Michail Schischkin ist ein mächtig ausgreifender Erzähler und Wortgläubiger mit Klassikerpotenz, wie man ihn schon lange nicht mehr sah in der russischen Weltliteratur.« NZZ am Sonntag, 24.04.2011