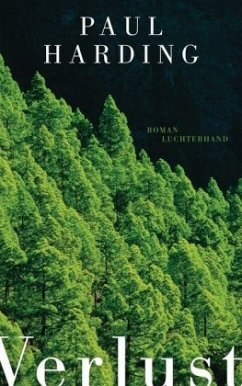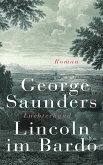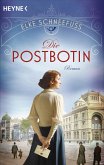Für »Tinkers« wurde Paul Harding mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Nun schreibt er die Geschichte der Familie Crosby, die in dem Städtchen Enon in Maine lebt, fort. Er erzählt vom Enkel George Washington Crosbys, davon, wie Charlie Crosby seine Familie verliert und fast auch seine Existenz. Grandiose Sprachbilder, intensive Naturbeobachtungen, visionäre Träume und immer wieder Erinnerungen, schmerzhaft und süß, bestimmen diesen herzzerreißenden Roman über Zeit und Sterblichkeit und den Verlust eines geliebten Menschen.
»Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr.« Damit beginnt die Geschichte von Charlie Crosby aus Enon, von seinem Weg durch die Hölle und, vielleicht, wieder zurück. Denn seine Trauer ist so maßlos, so allumfassend und unversöhnlich, dass sie sein Leben immer mehr zerstört. Seine Frau verlässt ihn bald nach dem Tod der Tochter, und Charlie, der sich in einem seiner Wutanfälle die Hand gebrochen hat, ernährt sich seitdem mehr oder weniger von Schmerztabletten und Alkohol und verwahrlost zusehends. Er kann sich um die Außenwelt nicht mehr kümmern, zu sehr nimmt ihn sein Innenleben gefangen: Gegenwart und Vergangenheit durchdringen sich, Erinnerungen an den verstorbenen Großvater, lange Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in den Wäldern von Maine, die Geschichte von Enon und auch von Salem, das ganz in der Nähe liegt, und seinen Hexen in früheren Zeiten - all das bestimmt seine Gedanken und sein Sein. Vor allem aber sind da immer wieder Erlebnisse und Gespräche mit seiner über alles geliebten Tochter, Entwürfe verschiedener Leben, die er mit ihr hätte erleben wollen. Denn er kann und will ihren Tod nicht akzeptieren ...
»Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr.« Damit beginnt die Geschichte von Charlie Crosby aus Enon, von seinem Weg durch die Hölle und, vielleicht, wieder zurück. Denn seine Trauer ist so maßlos, so allumfassend und unversöhnlich, dass sie sein Leben immer mehr zerstört. Seine Frau verlässt ihn bald nach dem Tod der Tochter, und Charlie, der sich in einem seiner Wutanfälle die Hand gebrochen hat, ernährt sich seitdem mehr oder weniger von Schmerztabletten und Alkohol und verwahrlost zusehends. Er kann sich um die Außenwelt nicht mehr kümmern, zu sehr nimmt ihn sein Innenleben gefangen: Gegenwart und Vergangenheit durchdringen sich, Erinnerungen an den verstorbenen Großvater, lange Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in den Wäldern von Maine, die Geschichte von Enon und auch von Salem, das ganz in der Nähe liegt, und seinen Hexen in früheren Zeiten - all das bestimmt seine Gedanken und sein Sein. Vor allem aber sind da immer wieder Erlebnisse und Gespräche mit seiner über alles geliebten Tochter, Entwürfe verschiedener Leben, die er mit ihr hätte erleben wollen. Denn er kann und will ihren Tod nicht akzeptieren ...

Der amerikanische Autor Paul Harding widmet sich dem Sterben in Maine
Wer in Amerika jemanden unter dem Raunen und Rauschen der Natur sterben lassen und nebenher naturkundliche Betrachtungen anstellen möchte, tut das gern in Maine. Der nördlichste Bundesstaat ist längst ein literarischer Lieblingsort. Hier bleiben Eigenbrötler unter sich, werden die Zeichen von Schmetterlings-, Vogelflug- und Bärenrouten studiert, wird im großen Atem von Wäldern und Ozean gelebt, gelitten und gestorben. Und literarisch auch immer wieder in Richtung der angrenzenden kanadischen Ontario-Region geschaut, die das Genre der Southern Ontario Gothic hervorgebracht hat.
Stephen King, John Irving, Susan Minot, Elizabeth Strout, Ayelet Waldman oder Gerard Donovan haben Bücher in Maine angesiedelt; Jonathan Lethem, Heidi Julavits, Ben Marcus oder John Hodgman verbringen im echten Leben gern ihre Sommer dort. Und nun reiht sich Paul Harding, der mit seinem ersten Roman "Tinkers" 2010 den Pulitzer-Preis gewonnen hat und mit dem neuen Buch "Verlust" eine Art Fortsetzung dazu vorlegt, in diese Reihe ein. Beide Romane spielen in Maine, der Autor selbst wohnt im nicht sehr weit entfernten Boston.
Allerdings hätte ein Tapetenwechsel dem neuen Werk gutgetan. Denn weder verlangt die Handlung von "Tinkers" notwendig nach Fortsetzung, noch braucht es für das Thema des aktuellen Romans einen Rückbezug auf das Sterben des Uhrmachers George Washington Crosby, seinerseits Sohn eines Kesselflickers und Großvater des "Verlust"-Protagonisten Charlie Crosby. Im Gegenteil, ein Roman über den Tod eines leiblichen Kindes, den schmerzlichsten aller Tode, muss nicht von landschaftlicher und familiengeschichtlicher Symbolik orchestriert werden. Da braucht es kein Streifen durch Wälder, keine Ornithologie, kein Uhrmachergleichnis, kein Orrery, um klarzumachen, wie verzweifelt der Wunsch sein kann, ein einziges Mal selbst Herr über den Lauf der Dinge, Uhren und Planeten zu sein.
Als Gustav Mahler seine Kindertotenlieder komponierte, soll seine Frau Alma fassungslos gewesen sein. Ein Vater, der in seiner künstlerischen Phantasie dem Tod eines Kindes nachgeht, während seine eigenen doch leben? Befremdlich. Auch Paul Harding ist Vater, und von daher hat er sich mit "Verlust" sicher kein leichtes Thema gesetzt. Vielleicht wirkt der Roman, der in dem fiktiven abgelegenen Ort Enon spielt, darum so konstruiert: Fünf Tage nachdem Charlie Crosbys dreizehnjährige Tochter Kate bei einem Autounfall gestorben ist und der Vater beim Abhören der Mailboxnachricht fast selbst ein Kind überfahren hätte, bricht er sich absichtlich die Hand; kurz darauf verlässt ihn seine Frau, nach einer Woche ist er schon zum Messie geworden. Es folgt eine Schmerzmittelabhängigkeit, einschließlich sozialer Verwahrlosung und Selbstmordversuch. Das dauert knapp zwei Jahre, zwei Naturzyklen lang. Danach ist Crosby reif für die Entzugsklinik. Schließlich beginnt ein bescheidenes neues Leben für den Ich-Erzähler, der, angekommen in seiner Untermiete-Wohnung und außerdem zum Vegetarier geworden, dann noch für vier Seiten ins Präsens wechselt.
Man glaubt diesem Erzähler, dass er früher in der Schule "jämmerliche Aufsätze" geschrieben habe, weiß aber trotzdem nicht so recht, wer ihn jetzt dazu verdonnert hat, seine Trauerarbeit aufzuschreiben. Die Therapeutin? Ab und zu zitiert der Gärtner und Gelegenheitsarbeiter sich oder seine Kollegen im O-Ton, mit etwas zu viel "geil" und "scheiße" zwar, aber dieser Crosby wäre interessanter gewesen als der perfekte Vater eines "prächtigen Kindes", dessen elegischer Ton sehr nahe an "Tinkers" ist und dessen Gedankenwelt mit einem argen Umkehrungskrampf beginnt: "Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme." Wenn ein Buch so anfängt, kann es kaum noch gut werden. Und dabei wirkt es, als würde Paul Harding beim Versuch, sich in den Ich-Erzähler zu versenken, ständig auf sich selbst zurückgeworfen werden und dieses Unvermögen, zu einem sprachlichen Charakter zu finden, durch einige künstliche Brüche gewaltsam bezwingen wollen.
Es ist kein fairer Vergleich, "Verlust" gegen Joan Didions "Blaue Stunden" von 2011 zu stellen. Letzteres Buch ist die literarische Verarbeitung des Todes von Didions Tochter Quintana Roo, das vorliegende eine Fiktion. Dennoch muss sie sich daran messen lassen. Und dabei wird umso deutlicher, dass Hardings Horror-Stilisierung von Trauerarbeit über lange Strecken kulissenhaft wirkt gegenüber einem tatsächlich empfundenen Leid. So überrascht es nicht, dass zu dieser Szenerie dann auch noch zwei Gothic-Teenies gehören, als eine Art Quadratur von Maine.
ASTRID KAMINSKI
Paul Harding: "Verlust".
Roman.
Aus dem Amerikanischen von Silvia Moravetz.
Luchterhand Literaturverlag, München 2015. 271 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Verlust" erscheint als Fortsetzung zu Paul Hardings Roman "Tinkers", kann aber mit dessen Grandiosität nicht mithalten, meint Rezensentin Astrid Kaminski. Den Rückbezug auf das Sterben des Uhrmachers George Washington Crosby hätte es nicht gebraucht, fährt die Kritikerin fort: Der hier geschilderte Tod des eigenen Kindes dürfte eigentlich Thema genug sein. Kaminski hat aber deutlich mehr an Hardings Roman auszusetzen: Auch der Handlungsort, das literarisch gern und häufig genommene Maine, erscheint der Kritikerin mit all seiner bedeutungsschweren Landschaftssymbolik überflüssig, um das Leiden am Sterben des Kindes zu veranschaulichen. Überhaupt wirkt der ganze Roman konstruiert und die Sprache wenig inspiriert, befindet die Rezensentin, der dieses Buch neben Joan Didions "Blaue Stunden" wie die "Horror-Stilisierung" von Trauerarbeit erscheint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH