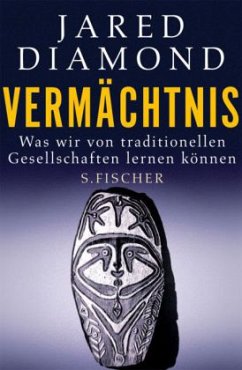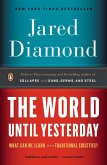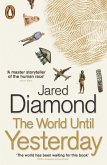Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können: nach dem Welterfolg von »Kollaps« - der neue Sachbuch-Bestseller von Jared Diamond!
Seit Jahrzehnten unternimmt Jared Diamond Expeditionen zu Stämmen, die noch traditionell als Jäger und Sammler leben - so, wie wir Menschen die längste und prägendste Zeit unserer Entwicklung gelebt haben. Fasziniert von der Fremdartigkeit ihrer Kultur führt er uns plastisch und unterhaltsam vor Augen, wie grundverschieden Menschen mit allen Facetten des Lebens umgehen und ihr Zusammenleben organisieren. Seine These: Wir können heute von diesen Kulturen viel lernen und so unsere aktuellen privaten und gesellschaftlichen Probleme lösen, von der Kindererziehung über staatliche Konflikte bis zum Umgang mit Alter und Tod. Ein spannender Blick auf die Vielfalt der menschlichen Kulturen - und eine überraschende Perspektive auf unser modernes Selbstverständnis.
»Jared Diamond schreibt mit Witz, Esprit und großem Sachverstand.« Die Welt
Seit Jahrzehnten unternimmt Jared Diamond Expeditionen zu Stämmen, die noch traditionell als Jäger und Sammler leben - so, wie wir Menschen die längste und prägendste Zeit unserer Entwicklung gelebt haben. Fasziniert von der Fremdartigkeit ihrer Kultur führt er uns plastisch und unterhaltsam vor Augen, wie grundverschieden Menschen mit allen Facetten des Lebens umgehen und ihr Zusammenleben organisieren. Seine These: Wir können heute von diesen Kulturen viel lernen und so unsere aktuellen privaten und gesellschaftlichen Probleme lösen, von der Kindererziehung über staatliche Konflikte bis zum Umgang mit Alter und Tod. Ein spannender Blick auf die Vielfalt der menschlichen Kulturen - und eine überraschende Perspektive auf unser modernes Selbstverständnis.
»Jared Diamond schreibt mit Witz, Esprit und großem Sachverstand.« Die Welt
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Detlev Claussen zeigt sich beeindruckt von Jared Diamonds Buch "Vermächtnis". Mit seinen Beobachtungen von traditionellen Gesellschaften stellt der Autor in den Augen des Rezensenten unser "Wir-Gefühl" als moderne Menschen infrage. Das Verhältnis von traditionellen und modernen Gesellschaften findet er in diesem Werk vielfach und erhellend thematisiert. Deutlich wird das für Claussen anhand von faszinierenden Ausführungen zu Themenfeldern wie Krieg, Gewalt, Gefahren, Regeln, Kindererziehung und den Umgang mit alten Menschen. Dass Diamond dabei auf eine plumpe Idealisierung der Lebensweisen von Horden und Stämmen ebenso verzichtet wie auf den Versuch, den Mythos von der Überlegenheit des "weißen Mannes" zu erneuern, weiß Claussen zu schätzen. Überzeugend findet er zudem das hohe anthropologische Reflexionsniveau des Autors, der dem Leser auch einen verständlichen Grundkurs in dieser Disziplin vermittelt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Passioniert und sehr nüchtern zugleich: Der Geograph Jared Diamond sichtet die Lebensweisen kleiner traditioneller Gesellschaften auf praktische Lehren für unsere Gegenwart - und hat zuletzt einige eher bescheidene Ratschläge.
Von Helmut Mayer
Der Ethnologe hatte viele Mühen auf sich genommen, um zu der kleinen Gruppe von Indianern vorzudringen. Es lockte die Aussicht, als Erster in ein noch unberührtes Dorf des einst berühmten Stamms zu gelangen. Doch noch vor dem Dorf stößt er im Regenwald auf deren Häuptling und vermutet gleich, was sich später bewahrheitet: Die Gruppe hat ihr Dorf endgültig verlassen, um sich am nächstgelegenen Militärposten der Zivilisation anzuschließen.
Nur mit Mühe gelingt es, die Indianer zu einem Aufschub zu überreden. Als sie sich auf den Rückweg ins Dorf machen, wirft der Helfer des Häuptlings seine Last kurzerhand in den Wald: Es ist ein lebender Harpyen-Adler, den sie als kostbares Geschenk - aus seinen Federn fertigen sie ihren traditionellen Schmuck - mit sich führten. Der Ethnologe findet das zuerst unbegreiflich. Doch dann kommen ihm Erzählungen anderer Begebenheiten aus der Geschichte der Kolonisierung in den Sinn. Sie berichten davon, wie schnell die überkommenen Werte von den kleinen traditionellen Gesellschaften annulliert werden, sobald bestimmte Elemente ihrer Lebensweise aufgekündigt werden.
Die berühmte Szene der Begegnung mit den Tupi-Kawahib, die Claude Lévi-Strauss in seinen "Traurigen Tropen" festhielt, hat emblematischen Charakter. Sie handelt von der Anziehungskraft, welche die Lebenserleichterungen der sich globalisierenden Gesellschaft auf die fragilen traditionellen Gesellschaften ausüben. Eine verständliche und gleichzeitig als fatal beschriebene Anziehung, denn sie löscht tendenziell deren kulturelles Erbe und damit ein ganzes Spektrum von Antworten, welches diese kleinen Gesellschaften ohne avancierte mechanische Künste auf Grundprobleme gefunden haben, die alle Gesellschaften für ihre Bestandssicherung lösen mussten. Antworten, die oft auf faszinierende Weise anders ausfallen als jene der global bestimmend gewordenen "westlichen" Welt.
An der weiter voranschreitenden Auflösung dieses Erbes - lange Zeit durch Gewalt, Zwang und eingeschleppte Krankheiten vorangetrieben - ist nicht zu zweifeln. Was freilich noch nicht bedeutet, den damit eintretenden Verlust klar bestimmt zu haben. Steckt in ihm "nur" die Einsicht, den Horizont der eigenen Gesellschaft nicht einfach für das Maß aller menschlichen Dinge zu halten (selbst wenn er de facto nicht zu überschreiten ist)? Oder kann man auch einen handfesteren, praktisch verwertbaren Nutzen aus dem Studium der kleinen traditionellen Gesellschaften ziehen? Nämlich Antworten auf Probleme zu finden, mit denen wir uns selbst in modernen Gesellschaften herumschlagen?
Claude Lévi-Strauss hat in späteren Jahren versucht, Beispiele für genau solche Nutzanwendungen zu finden (F.A.Z. vom 19. Juli). Und auch ein gerade - Stichwort "Occupy" - ins Blickfeld geratener Autor mit ethnologischen Wurzeln, David Graeber, verknüpft seine Kritik an den ökonomischen Imperativen unserer Gesellschaft gerne mit Hinweisen auf die anderen Sozialformen in traditionellen Gesellschaften.
Nun hat sich Jared Diamond dieser Frage angenommen, was wir von den traditionellen Gesellschaften lernen können. Der Geograph und ausgewiesene Kenner der Entwicklungsgeschichten menschlicher Gesellschaften tut das nüchterner und systematischer als kulturkritische Romantiker und kapitalismuskritische Streiter. In Büchern wie "Arm und Reich" und "Kollaps" hat er vor Augen geführt, wie viele Faktoren für den Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklungspfade von Bedeutung waren; dass aber auch ganz bestimmte und zufällig erfüllte Voraussetzungen darüber entschieden, welche Gesellschaften einen entscheidenden Startvorteil bekamen und deshalb zuletzt zu Siegern im globalen Maßstab werden konnten: jene nämlich, die ursprünglich in ihrem Siedlungsgebiet reichlich über domestizierbare Tier- und Pflanzenarten verfügten.
Die globalen Sieger sind die großen, staatsförmig verfassten Gesellschaften. Die traditionellen Gesellschaften, die Diamond mit Blick auf seine Leitfrage durchmustert, sind dagegen zum größten Teil Horden von einigen Dutzend oder Stämme von einigen hundert Mitgliedern: Größenordnungen, in denen alle Mitglieder einander entweder direkt kennen oder zumindest in Verwandtschafts- und Clanbeziehungen einordnen können - was weder politische Zentralisierung noch Hierarchisierung oder gar bürokratische Eliten und universalisierbare Maximen des Verhaltens erfordert.
Diamond zieht Berichte über solche Gesellschaften in allen möglichen Weltgegenden heran, mit einer Massierung in Neuguinea und benachbarten Pazifikinseln. Letztere verdankt sich zum einen dem Umstand, dass die Dichte solcher Gesellschaften dort tatsächlich hoch ist, zum anderen den Erfahrungen, die der passionierte Ornithologe und Feldforscher Diamond dort selbst über Jahrzehnte hinweg gemacht hat. Die Facetten des sozialen Lebens, die er seiner vergleichenden Betrachtung unterzieht, sind: Gewalt und Krieg, Konfliktregelung insbesondere bei Tötungen, Kindererziehung, Umgang mit Alten, Essgewohnheiten, Umgang mit Gefahren.
Diamonds Übersicht ist reich an Beispielen, stützt sich auf eine breite Basis vor allem angelsächsischer Literatur, vergisst dabei nie, die methodischen Schwierigkeiten der Erhebungen zu berücksichtigen, und wird lebendig durch des Autors eigene Erzählungen. Wie kaum anders zu erwarten, ist das Spektrum der beobachteten Praktiken breit. Eine sesshafte Gesellschaft mag ihre hinfälligen Alten wertschätzen, die nomadisierenden Horden können sich das dagegen schlicht nicht leisten, weshalb Aussetzung, nahegelegter Selbstmord und Mord mit Einstimmung des Opfers ins Repertoire gehören. Der Grad der kriegerischen Auseinandersetzungen mag variieren, aber im Schnitt ist die entsprechende Opferrate trotz der elementaren Kampftechniken deutlich höher als in den großen Staatsgesellschaften. Was sich nicht zuletzt dem Umstand verdankt, dass Fehden die Tendenz haben, in ein Hin und Her endloser Racheaktionen zu münden. Bei der Kindererziehung wiederum mag der eine Stamm jede Züchtigung ächten, während ein anderer sie praktiziert.
Manche dieser Praktiken lassen sich ökologisch einsichtig machen, also aus den Subsistenzbedingungen der ins Auge gefassten Gesellschaften, andere sperren sich einer solchen Erklärung. Die uns grausam erscheinende Praxis der Altenbeseitigung bei nomadisierenden Horden zählt zur ersten Kategorie. Aber bei der Züchtigung von Kindern etwa oder der Praxis der Geburt etablieren sich unter ähnlichen Randbedingungen ganz unterschiedliche Traditionen.
Man ahnt, während man dem Parcours des Buchs folgt, was parteiische Interpreten mit kulturkritischer Agenda aus diesem Material herauszupfen würden. Aber Diamonds unbeirrbare Nüchternheit bei gleichzeitiger Zuwendung zu den dargestellten Gesellschaften ist musterhaft. Es weiß auch kaum jemand so gut wie er, dass in ihnen die Probleme noch gar nicht auftauchen, welche die großen Gesellschaften für ihren Bestand lösen mussten. Übertragungen über diese Größengrenze hinweg schließt dieser einfache Sachverhalt meist sehr schnell aus.
Deshalb ist auch äußerst bescheiden, was Diamond zuletzt an konkreten Lehren anzubieten hat. Etwa Diätempfehlungen (weniger Salz und Zucker), für die man mittlerweile nicht unbedingt die anthropologische Herleitung braucht; ein Lob kognitiver Vorzüge mehrsprachiger Erziehung, das genauso wie einige Vorschläge zum Umgang mit kleinen Kindern auf sehr wackligen Befunden fußt; den Hinweis auf mögliche Vorzüge von außergerichtlichen Mediationen und freiwilligen Konfrontationen von Opfern und Tätern im Rahmen von Gerichtsverhandlungen (wie sie hierzulande bereits praktiziert werden).
Diese kaum beeindruckende Ausbeute lässt den vollmundigen Titel der deutschen Ausgabe, "Vermächtnis", sehr unglücklich aussehen. Doch muss man das Buch nicht an diesem schmalen Ertrag messen. Es erzählt auf disziplinierte und gleichzeitig farbige Weise davon, dass der Raum des Menschlichen größer ist als der, den unsere Gesellschaft umreißt. Mit anderen Worten: Die Ethnologen und Anthropologen erzählen uns von Möglichkeiten, die unsere schon nicht mehr sind. Lehrreich ist auch das. Es lädt zur Selbstbescheidung ein.
Jared Diamond: "Vermächtnis". Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können.
Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2012. 586 S., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Diamonds größtes Verdienst liegt in der Popularisierung der großen existentiellen Themen und in der Fähigkeit, über enge Fachdisziplinen hinwegzuspringen. Winand von Petersdorff Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20141116