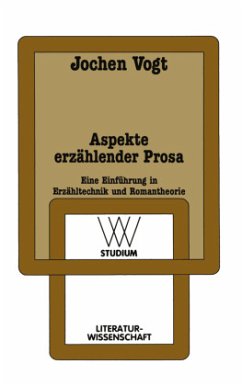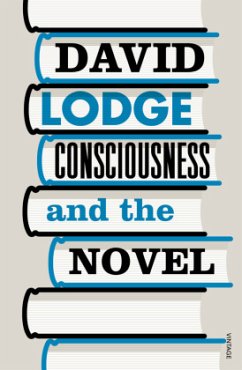Nicht lieferbar
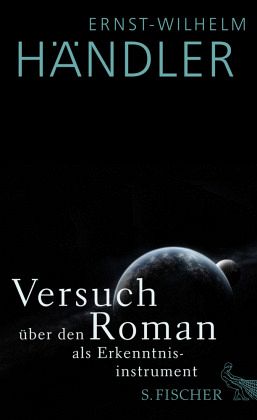
Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument - Ein inspirierender Essay über die Erkenntniskraft der LiteraturKann Literatur dem Menschen zu Erkenntnissen verhelfen, die die Wissenschaften nicht liefern können? Ernst-Wilhelm Händler geht dieser Frage in seinem hochkonzentrierten Essay Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument auf den Grund. Insbesondere den Roman als umfassendste Literaturgattung sieht er als Schlüssel zu einem forschenden Blick auf uns selbst und die Gesellschaft.Zur Klärung dieser These zieht Händler Ideen und Begriffe aus der Systemtheorie, Logik, Neurologi...
Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument - Ein inspirierender Essay über die Erkenntniskraft der Literatur
Kann Literatur dem Menschen zu Erkenntnissen verhelfen, die die Wissenschaften nicht liefern können? Ernst-Wilhelm Händler geht dieser Frage in seinem hochkonzentrierten Essay Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument auf den Grund. Insbesondere den Roman als umfassendste Literaturgattung sieht er als Schlüssel zu einem forschenden Blick auf uns selbst und die Gesellschaft.
Zur Klärung dieser These zieht Händler Ideen und Begriffe aus der Systemtheorie, Logik, Neurologie und Robotertechnik heran. In kompakter Form klärt er zunächst die Voraussetzungen des menschlichen Erkenntnisstrebens - Bewusstsein, Sprache, Erinnerung, Wahrnehmung und Gefühle -, um zu einer ganz eigenen, hoch inspirierenden Kulturtheorie zu finden. Ein Muss für alle, die sich für die Erkenntniskraft der Literatur interessieren.
Kann Literatur dem Menschen zu Erkenntnissen verhelfen, die die Wissenschaften nicht liefern können? Ernst-Wilhelm Händler geht dieser Frage in seinem hochkonzentrierten Essay Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument auf den Grund. Insbesondere den Roman als umfassendste Literaturgattung sieht er als Schlüssel zu einem forschenden Blick auf uns selbst und die Gesellschaft.
Zur Klärung dieser These zieht Händler Ideen und Begriffe aus der Systemtheorie, Logik, Neurologie und Robotertechnik heran. In kompakter Form klärt er zunächst die Voraussetzungen des menschlichen Erkenntnisstrebens - Bewusstsein, Sprache, Erinnerung, Wahrnehmung und Gefühle -, um zu einer ganz eigenen, hoch inspirierenden Kulturtheorie zu finden. Ein Muss für alle, die sich für die Erkenntniskraft der Literatur interessieren.