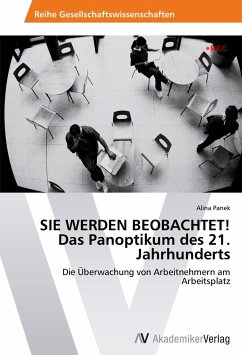Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Sie muß gegen den Zugriff staatlicher Macht ebenso verteidigt werden wie gegen Übergriffe aus der Gesellschaft. Prinzipien wie Sicherheit, Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit werden zunehmend gegen das Recht auf Privatheit in Stellung gebracht. Wuchernde Bürokratien, Obrigkeitsdenken, aber auch gedankenlose Bequemlichkeit und mediale Geltungssucht untergraben den Sinn für den Wert des Privaten. Wolfgang Sofskys Streitschrift weist über die aktuelle Debatte um Überwachung, Sicherheit und Datenschutz weit hinaus. Entschieden plädiert sie für den Wert aller Freiheiten des Individuums.
Nicht erst seit den letzten Terroranschlägen ist die Freiheit der Bürger durch patriotische Sicherheitsgesetze gefährdet. Die Abgrenzung einer privaten Eigensphäre ist eine Aufgabe, vor die sich das menschliche Gattungswesen in jeder Zivilisation gestellt sieht. Denn Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Sie markiert eine strikte Barrieregegen jedwede soziale und politische Macht. Die Selbstbehauptung des Individuums beginnt mit dem Schutz vor unerbetener Berührung und Belästigung, vor Glaubens- und Gefühlskontrollen und reicht über intime Geheimnisse bis zur Verteidigung eigener Handlungsräume. Wolfgang Sofsky untersucht die wichtigsten Aspekte der privaten Existenz: Körper und Raum, Information und Eigentum, Religion und Gedankenfreiheit. Dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Sicherheit und Wohlstand, so die These, wird das Recht auf Privatheit heute leichtfertig geopfert. Der moderne Staat sucht das Denken zu formieren, Unterschiede einzuebnen und die "gläsernen Untertanen" an eine öffentliche "Anstaltsordnung" anzupassen. Für vermeintlich höhere Zwecke und Pflichten sollen sie auf ihre Privatsphäre sogar freiwillig verzichten. So weit reichen mittlerweile die Ansprüche von Staat und Gesellschaft, daß das Beharren auf Eigensinn als sozialer Verrat erscheint. Doch Privatheit gewährt jedem das Recht, in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben und sein eigenes Wohl zu erstreben, und zwar auf die ihm eigene Weise.
Nicht erst seit den letzten Terroranschlägen ist die Freiheit der Bürger durch patriotische Sicherheitsgesetze gefährdet. Die Abgrenzung einer privaten Eigensphäre ist eine Aufgabe, vor die sich das menschliche Gattungswesen in jeder Zivilisation gestellt sieht. Denn Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Sie markiert eine strikte Barrieregegen jedwede soziale und politische Macht. Die Selbstbehauptung des Individuums beginnt mit dem Schutz vor unerbetener Berührung und Belästigung, vor Glaubens- und Gefühlskontrollen und reicht über intime Geheimnisse bis zur Verteidigung eigener Handlungsräume. Wolfgang Sofsky untersucht die wichtigsten Aspekte der privaten Existenz: Körper und Raum, Information und Eigentum, Religion und Gedankenfreiheit. Dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Sicherheit und Wohlstand, so die These, wird das Recht auf Privatheit heute leichtfertig geopfert. Der moderne Staat sucht das Denken zu formieren, Unterschiede einzuebnen und die "gläsernen Untertanen" an eine öffentliche "Anstaltsordnung" anzupassen. Für vermeintlich höhere Zwecke und Pflichten sollen sie auf ihre Privatsphäre sogar freiwillig verzichten. So weit reichen mittlerweile die Ansprüche von Staat und Gesellschaft, daß das Beharren auf Eigensinn als sozialer Verrat erscheint. Doch Privatheit gewährt jedem das Recht, in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben und sein eigenes Wohl zu erstreben, und zwar auf die ihm eigene Weise.

Moralprediger, Toleranzprüfer, Steuereintreiber: Sie alle greifen die Privatsphäre an. Dabei ist sie der Hort der Freiheit
VON WOLFGANG SOFSKY
Frei ist, wer nicht angegriffen wird. Privatheit ist die Zitadelle der persönlichen Freiheit. Sie bewahrt vor Enteignung und Entmündigung, vor Aufdringlichkeit und Bevormundung, vor Macht und Zwang. Unbefugten ist der Zutritt verwehrt. Die Festung sichert Selbständigkeit und Selbstbestimmung. Unerbetene Eingriffe prallen an ihren Bastionen ab. Der Zugang zu persönlichen Daten ist ebenso versperrt wie der Zutritt zu den Räumen der Intimität.
Wie jede Freiheit ist Privatheit zuerst negativ. Die Mauern sind Bollwerke gegen äußere Eindringlinge und innere Verräter. Sie werden verteidigt, indem man seine Geheimnisse wahrt, fremder Einmischung Schranken setzt, ein Glacis sozialer Distanz planiert. Der Privatier legt Wert auf Abstand. Weil Menschen jederzeit verletzbar sind, können sie einander stets gefährlich werden. In der physischen Konstitution des Homo sapiens findet Privatheit ihren letzten Grund. Der eine versucht, den anderen beiseite zu drängen, zu unterwerfen, seine Bewegungen einzuschränken, seine Gefühle, Gedanken und Gesten zu lenken, sich seines Leibs, seines Verstandes zu bemächtigen. In jeder Gesellschaft muss daher der Einzelne seinen Platz gegen Übergriffe behaupten. Die Privatsphäre hält andere in sicherer Entfernung und verschafft der Person einen Platz in der Welt.
Der Angreifer sind viele. Das Heer der Eindringlinge reicht von besorgten Eltern, misstrauischen Verwandten und neugierigen Nachbarn über selbsternannte Moralprediger, Toleranzprüfer, ehrgeizige Meinungsmacher und Gesinnungspädagogen bis zu den Steuereintreibern, Spitzeln und Wachposten der Fürsorge. Sie alle verstoßen gegen das Freiheitsrecht des Einzelnen, in Ruhe gelassen zu werden.
Der Grenzwall des Privaten ist kein Ort friedlicher Eintracht. In einer freien Gesellschaft herrscht keine freudetrunkene Brüderlichkeit. Denn die Freiheit des einen endet, wo jene des anderen beginnt. Es gehört zum Paradoxon negativer Freiheit, dass sie fortwährend erstritten werden muss. Rechtliche Garantien zählen wenig, wenn andere sie nicht akzeptieren und der Staat unter dem Vorwand der Gerechtigkeit fortwährend Gesetze zur Freiheitsbeschränkung beschließt. Geheimnisse müssen daher gegen Neugier, private Reviere gegen Eindringlinge gesichert werden. Nach innen ist die Mauer zudem gegen das Aufbegehren der Individuen zu verteidigen. Im Privaten tobt auch der Streit der Geschlechter, Geschwister und Generationen. Nicht selten suchen sie Verstärkung bei Verbündeten jenseits des Walls. Sie öffnen die Tore, rufen nach Rechtsbeistand oder parteilicher Schlichtung. Und zeitweise drängen Privatleute selbst nach draußen, um sich auf Kosten der Zurückgelassenen ins Rampenlicht zu setzen und ihre persönlichen Interessen in der Öffentlichkeit durchzusetzen.
Zu den ärgsten Feinden der Freiheit zählt neben der Macht auch die soziale Verdichtung. Sie ergibt sich aus dem Integrationsgrad der Gesellschaft. Wo jeder jeden kennt, ist Privatheit kaum zu wahren. Solange Menschen in geschlossenen Gruppen mit starken Bindungen leben, etwa in einem abgelegenen Dorf oder in einem Gefängnis, sind ihre Beziehungen eng und überschaubar. Insassen und Eingesessene bezahlen ihre Vertrautheit jedoch mit dem Verlust ihrer Freiheit. Nichts bleibt der Aufmerksamkeit der Nachbarn, der Sippe, der Gemeinschaft verborgen. Jeder Verstoß gegen Sitte und Etikette wird sofort registriert.
Erst wenn sich die Abstände vergrößern und die Mobilität zunimmt, steigen auch die Freiheiten. Flüchtige Begegnungen unter Fremden ersparen dem Einzelnen aufwendige Darstellungen seines Innenlebens. Seine Persönlichkeit ist nicht gefragt, sein sozialer Status ohne Belang, sein Rang häufig nicht einmal erkennbar. Anonymität ist für den Schutz des Privaten unverzichtbar. Auf der Dorfstraße begegnen sich Menschen, die einander kennen. Ganz anders der Gang durch die City einer Großstadt. Viele bewegen sich wortlos durch die Geschäftsstraßen, schlängeln sich durch die Menge, taxieren kurz die wildfremden Gestalten, die ihnen entgegeneilen. Die Gesprächsthemen unter Fremden sind begrenzt. Man kann nach der Uhrzeit oder dem Weg fragen, notfalls auch über das Wetter reden. Nur der Besucher vom Lande erzählt bei dieser Gelegenheit, wen er zu besuchen gedenkt und warum er sich nicht auskennt. Er hebt die Anonymität auf, weil er in der unwirtlichen Umgebung ängstlich nach Zeichen für Vertrauen sucht.
Der historische Ort der modernen Privatsphäre ist die große Stadt. Hier tritt der Gegensatz von Öffentlichkeit und Privatheit krass hervor. Auf dem Marktplatz für Güter und Eitelkeiten zählen nicht die Individuen, sondern die Käufer der Dinge und die Verkäufer ihrer selbst. Beim Tausch der Werte geht der Kunde von Stand zu Stand, von Geschäft zu Geschäft. Keiner muss den anderen kennen, aber jeder kann mit dem anderen in Kontakt treten. Auf dem Markt bewegen sich unzählige Privatleute. Jeder hat Zutritt. Davon ist die private Wohnung scharf abgegrenzt. Sie ist dem Bewohner allein vorbehalten. In den eigenen Wänden kann einem niemand vorschreiben, was man zu tun oder zu lassen hat.
Nur wenn private Angelegenheiten den Menschen selbst überlassen bleiben, kann sich eine Vielfalt von Lebensformen entwickeln, die einer Gesellschaft Farbe und Dynamik verleihen. Soziale Mannigfaltigkeit schwindet mit dem Grad der äußeren Einmischung. Meinungsdruck gleicht die Haltungen und Vorstellungen der Menschen einander an. Vorschriften unterdrücken die freie Selbsttätigkeit. Fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hilfe nehmen dem Einzelnen den Ansporn, selbst auf Auswege zu sinnen und die eigenen Kräfte einzusetzen. Jede Freiheitsbeschränkung dämpft die Energie des Handelns und raubt den Menschen die Chance, den Enthusiasmus eigener Leistung für sich zu verbuchen. Was nicht von dem Menschen selbst gewählt, worin er eingeschränkt und geleitet wird, das geht nicht ein in sein Selbstbewusstsein. Es bleibt ihm fremd. Für soziale Vielfalt und persönliches Wachstum ist die freie Selbsttätigkeit gleichermaßen unabdingbar.
Wie jede Freiheit garantiert auch die Privatheit nicht das moralisch Gute. In ihren geheimen Verliesen gedeihen manch sonderbare Neigungen. Die Vorlieben der Menschen sind selten wertvoll, tugendhaft, edel oder schön. Das Erstaunen über die banalen Präferenzen vieler Privatleute beruht auf der Verwechslung von Freiheit und Moral. Freiheit ist keine Tugend, sondern die Voraussetzung aller Tugend. Aber solange niemand geschädigt oder seiner Freiheit beraubt wird, sind die privaten Angelegenheiten tabu. Was den Privatmann angeht, geht niemanden sonst etwas an. Privatheit ist - wie die Freiheit - ein Wert, den Menschen um seiner selbst willen schätzen. Sie ist kein Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck.
Es gehört zum angestammten Recht eines jeden, von seiner Freiheit keinen Gebrauch zu machen. Niemand ist dazu verpflichtet, die Freiheit, welche ihm die Privatsphäre bietet, tatsächlich zu nutzen. Niemand ist gehalten, sich selbstkritisch seiner Wünsche und Handlungen zu versichern. Niemand ist dazu verurteilt, seinen Begabungen zu folgen, sich selbst zu verwirklichen oder gar ein besserer Mensch zu werden. Es ist ganz und gar unzulässig, die Privatsphäre einzuschränken, nur weil Menschen sich weigern, vermeintlich höheren Werten nachzustreben. Wer nichts aus sich macht, verdient ebenso private Freiheit wie derjenige, der die Gelegenheit zur Vervollkommnung seiner selbst zielstrebig ergreift. Individuelle Fähigkeiten sind keine öffentlichen Güter. Wer seine Potenzen nicht ausschöpft, vergeudet daher auch kein öffentliches Gut. Besser als jede Obrigkeit wissen die Menschen selbst, was für sie das Gute ist.
Unter dem Vorwand, es sei doch nur zu ihrem Besten, mischt sich der moderne Staat in alles ein, und zwar auch gegen den ausdrücklichen Willen der Untertanen. Vorsorge und Fürsorge sind jedoch nur fadenscheinige Versprechen. Der Staat ist weder ein Hort der Sittlichkeit noch eine moralische Anstalt. Er hütet kein Gemeinwohl und ist auch keine Quelle väterlicher Geborgenheit. Der Staat ist eine Einrichtung zur Beherrschung der Bürger. Mit dem Umfang der Registraturen und der Zahl der Staatsdiener nimmt die Freiheit der Bürger ab. Fern jedes moralischen Fortschritts kennt die Entwicklung des Staates nur eine Richtung: Vorwärts in der Entmündigung und Enteignung der Bürger!
Die Gerechtigkeit, die er zu verwirklichen vorgibt, benötigt immer mehr Gesetze, die Gesetze benötigen immer mehr Bedienstete, und die Bediensteten benötigen immer mehr Geld von den Untertanen, die sich von den Bediensteten zu Unrecht immer mehr Gerechtigkeit erhoffen. Die Festung des Privaten schützt daher nicht nur den Bürger. Sie bewahrt die Staatsmacht vor der Versuchung, sich immer weiter auszudehnen, anstatt sich der einzigen Aufgabe zu widmen, die ihr zukommt: der Sicherung der Freiheit.
Der Text ist ein Auszug aus dem Buch: Wolfgang Sofsky, Verteidigung des Privaten. Eine Streitschrift. Es erscheint am 22. August 2007. Verlag C.H. Beck oHG, 2007. 158 Seiten. 14,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
"Keine Freiheit ohne Privatheit" lässt sich der stilbewusste Essay des Soziologen Wolfgang Sofsky auf den Punkt bringen, so Rezensent Harry Nutt. Sofskys philosophisch-anthropologische Streitschrift lote das Verhältnis von "Privatheit, Freiheit und Macht" angesichts zunehmend neuer Formen staatlicher Datenüberwachung, aber auch willfähriger bürgerlicher Aufgabe des Datenschutzes in der alltäglichen hochtechnologisierten Welt aus. Auch wenn der Rezensent Sofsky in seinen originellen Schlussfolgerungen und überraschenden Verknüpfungen gerne zustimmen möchte, findet er viele Begründungen zu kurz gedacht und vermutet den Grund dafür im ausgeprägten Stilwillen des Autors. Dessen "kurze, apodiktische Sätze" wollen eben nicht mit Argumenten und Empirie überzeugen, sie fordern den gläubigen Leser, meint Nutt, der sich mit dieser Rolle nicht anfreunden kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH