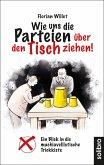Keine Institution wurde in Deutschland so oft totgesagt wie das Parlament. Populisten verachten es und träumen von einer plebiszitären Demokratie. Ist parlamentarische Politik nur noch dazu da, Entscheidungen der Bundesregierung nachträglich zu legalisieren? Der Jurist Florian Meinel analysiert messerscharf, wie das deutsche Regierungssystem wurde, was es ist, und welche Stürme es heute überstehen muss.
Der Erfolg der AfD stellt die politischen Gewissheiten der Bundesrepublik in Frage. Das Ende des alten Wettbewerbs der Volksparteien hat alle Verfassungsorgane erfasst. Disruptive Politik geht heute scheinbar ohne Parlament: Abschaffung der Wehrpflicht, Euro-Rettung, Flüchtlingskrise, Ehe für alle. Was oft dem Regierungsstil Angela Merkels zugeschrieben wird, hat viel tiefere Ursachen. Der missverstandene Parlamentarismus ist die verletzlichste Errungenschaft der alten Bundesrepublik. Wie lässt er sich heute fortentwickeln? Welche politische Chance läge in Minderheitenregierungen? Oder müssen wir das Zweikammersystem grundsätzlich umbauen, damit Deutschland regierbar bleibt? Meinels Buch ist eine Verteidigung des Parlamentarismus und zugleich eine Verlustbilanz der Großen Koalition.
Der Erfolg der AfD stellt die politischen Gewissheiten der Bundesrepublik in Frage. Das Ende des alten Wettbewerbs der Volksparteien hat alle Verfassungsorgane erfasst. Disruptive Politik geht heute scheinbar ohne Parlament: Abschaffung der Wehrpflicht, Euro-Rettung, Flüchtlingskrise, Ehe für alle. Was oft dem Regierungsstil Angela Merkels zugeschrieben wird, hat viel tiefere Ursachen. Der missverstandene Parlamentarismus ist die verletzlichste Errungenschaft der alten Bundesrepublik. Wie lässt er sich heute fortentwickeln? Welche politische Chance läge in Minderheitenregierungen? Oder müssen wir das Zweikammersystem grundsätzlich umbauen, damit Deutschland regierbar bleibt? Meinels Buch ist eine Verteidigung des Parlamentarismus und zugleich eine Verlustbilanz der Großen Koalition.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rudolf Walther findet in Florian Meinels Buch eine lehrreiche Einführung in das Parlamentswesen. Inwiefern das Parlament zwischen Verfassung und Regierung vermittelt und die Basis der Demokratie darstellt, vermag ihm der Autor zu erläutern, ohne zu spekulieren, dafür mit Sinn für das Grundsätzliche der Rolle der Verfassung im parlamentarischen Regierungssystem. Überzeugend findet Walther den Autor unter anderem, wenn er den Mythos des konfrontativen Parlaments entlarvt, das Wirken der Ministerialbürokratie kritisch beäugt und den Sinn eines reinen Mehrheitswahlrechts hinterfragt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ursprünge und Gründe der heutigen Krise des Parlamentarismus
Wenn sich die repräsentative Parteiendemokratie heute, wie allenthalben behauptet, in einer Krise befindet, muss sich das zunächst in ihrer zentralen Institution bemerkbar machen - dem Parlament. In den verbreiteten Klagen über dessen Bedeutungsverlust laufen zwei Stränge zusammen. Der eine, neuere Strang hebt auf die sich seit den neunziger Jahren stark verändernden Rahmenbedingungen des Regierens ab - von den Prozessen der Denationalisierung bis hin zur Pluralisierung der Medienlandschaft. Der andere Strang ist historisch älter. Er macht den Niedergang an der Stellung des Parlaments im Gewaltenteilungsgefüge fest, wo ihnen die Regierungen als eigentliche Gesetzgeber den Rang abgelaufen hätten. Dies betrifft vor allem die parlamentarischen Regierungssysteme, die institutionell auf der Verbindung ("Gewaltenfusion") von Regierung und parlamentarischer Mehrheit gründen und sich darin vom gewaltentrennenden präsidentiellen System unterscheiden. Die kompakte Abhandlung des Würzburger Staatsrechtlers Florian Meinel über den bundesdeutschen Parlamentarismus - Nebenprodukt und Destillat einer demnächst erscheinenden, wesentlich umfangreicheren Habilitationsschrift - reiht sich in den zuletzt genannten, älteren Strang ein. Seine zentrale These lautet, dass sich das parlamentarische Regierungssystem hierzulande niemals "richtig" durchgesetzt habe. Es sei nur eine Schicht des Staats- und Verfassungsaufbaus, dem mit "dem halb verfassungsrechtlichen, halb politischen Arrangement aus Landesexekutiven, Bundesrat und Länderkoordinierung", ein administrativ-föderaler Komplex als zweite, ältere und politisch ganz anders funktionierende Verfassungsschicht gegenüberstehe. Dieses System habe nur funktionieren können, weil beide Schichten unterhalb der formellen Verfassungsebene durch drei "originär bundesrepublikanische Institutionen" - die Volksparteien, das Bundeskanzleramt und das Bundesverfassungsgericht - miteinander verknüpft worden seien. Gerade diese Vermittlungsinstitutionen gerieten aber heute selbst in die Krise, weil sie entweder erodiert seien (wie die Volksparteien) oder ihre vermittelnde Funktion im Verhältnis zum Parlament und zur regierenden Mehrheit überdehnt hätten (wie Kanzleramt und Verfassungsgericht).
Ausgehend von dieser Generalthese spürt der Autor die Funktionsschwächen, Ungereimtheiten und Inkonsistenzen der parlamentarischen Regierungsform ebenso minutiös wie treffsicher auf. Warum findet die Kanzlerwahl im Bundestag als geheime Wahl statt, während über die Vertrauensfrage offen abgestimmt wird? Warum ist das sogenannte Zitierrecht, also die Herbeirufung eines Ministers, an eine Mehrheitsentscheidung gebunden? Warum ist die Verbindung von Regierungsamt und Parlamentsmandat nur erlaubt, aber nicht geboten? Warum haben nicht nur die Mitglieder der Bundesregierung und des Bundesrates, sondern auch ihre Beauftragten, also Landes- und Bundesbeamte, im Bundestag ein Anwesenheits- und sogar Rederecht? Die Liste ließe sich noch erweitern, etwa um den in der Literatur selten (und auch von Meinel nicht) erwähnten Umstand, dass die Abgeordneten zwar Amtsinhaber sind, als solche aber im Unterschied zu den Regierungsmitgliedern und Beamten keinen Eid leisten müssen.
Meinels Vorwurf, dass sich weder das Staatsrecht noch die Politikwissenschaft bemüht hätten, diese grundsätzlichen und kleineren Widersprüche theoretisch aufzuklären, ist, zumindest was die Politikwissenschaft betrifft, nicht haltbar. Theodor Eschenburg und Gerhard Lehmbruch haben eindrucksvolle Analysen über die "pfadabhängige" Entwicklung der politischen Institutionen in Deutschland vorgelegt und dabei zugleich deren Anpassungsfähigkeit hervorgehoben. So ist etwa dem Bundesrat, den Bismarck als monarchisches Gegenwicht zum aufstrebenden Reichstag konzipiert hatte, die Integration in das demokratische Regierungssystem gelungen. Auf der anderen Seite haben die Widersprüche auch mit den unterschiedlichen Funktionsanforderungen der demokratischen Regierungsweise zu tun, die Partizipations-, Transparenz und Effizienzgesichtspunkten gleichermaßen Rechnung tragen muss. Die Zielkonflikte lassen sich hier zum Beispiel am Problem der Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen festmachen.
Die normative Orientierung am britischen Urtyp des parlamentarischen Regierungssystem wirkt vor diesem Hintergrund eher befremdlich. Sie scheint vor allem in den Ausführungen über das Wahlsystem durch. Dort wird ein funktionaler Zusammenhang des parlamentarischen Systems mit dem Mehrheitswahlrecht behauptet, das in der Bundesrepublik ebenso wenig besteht wie in fast allen anderen parlamentarischen Systemen und das auch keine Chance auf Einführung hat - was der Autor natürlich weiß und offen einräumt. Das vermeintliche Vorbild ist auch deshalb keines, weil Großbritannien die föderalen und verfassungsstaatlichen Elemente, die in Deutschland der Einführung der parlamentarischen Regierungsform vorausgingen, heute in sein eigenes System übernimmt, weil es nur so den Zusammenhalt des Königreiches sichern kann. Gemessen daran und dem seit 2016 stattfindenden Brexit-Drama, bleibt die Krise des Parlamentarismus in der Bundesrepublik überschaubar.
So klug das gut zu lesende Buch im Einzelnen argumentiert, so wenig vermag es die Widersprüchlichkeiten des Parlamentarismus aufzulösen, die als Ursache der Systemkrise beschrieben werden. Entsprechend vage und unentschieden bleiben Meinels eigene Reformüberlegungen. Hier wird meistens nur gezeigt, warum etwas nicht geht oder welche Fallstricke es birgt - etwa beim Thema Minderheitsregierungen oder der Reform des Bundesrates. Der Autor ist ein Meister des Zweifels - und lässt den Leser gerade deshalb am Ende ziemlich ratlos zurück.
FRANK DECKER
Florian Meinel: Vertrauensfrage. Zur Krise des heutigen Parlamentarismus.
C.H. Beck Verlag, München 2019. 238 S., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Der Aufstieg der Rechtspopulisten ist auch Ausdruck des Vertrauensverlustes in den Parlamenterismus - damit in eine zentrale Idee der liberalen Demokratie: die Repräsentation. Meinel erklärt, was wir an ihr haben."
Jens-Christian Raabe, Süddeutsche Zeitung
"Eine pointierte, aber unaufgeregte und an verborgenen Einsichten reiche Analyse."
Recht und Politik, Stefan Lenz
"Florian Meinel untersucht die Mikrostruktur unserer Verfassungsorganisationen und regt zum Nachdenken an."
zdf kultur, Thorsten Jantschek
"Meinel beweist mit seiner lebendig geschriebenen Analyse des parlamentarischen Regierungssystems den Mut und die Gabe, aus dem Schutzschild des juristischen Fachjargons herauszutreten."
Neue Justiz, Katja Gelinsky
"Florian Meinel hat mit ,Vertrauensfrage' ein kluges Buch geschrieben, das vor Augen führt, wie erhellend und spannend ein Blick auf die Mechanismen unseres parlamentarischen Systems sein kann."
Tagesspiegel, Florian Keisinger
"Florian Meinel beantwortet die aktuelle Frage nach der Zukunft der parlamentarischen Demokratie in Deutschland."
Neue Württembergerische Zeitung, Gunther Hartwig
"Thesenstarker Band (...) origineller Aufschlag, in dem nicht davor zurückgeschreckt wird, 'einmal grundsätzlicher und größer zu denken'"
Im Gegenlicht, Karl Adam
"Dieses Buch ist eines von denjenigen Werken, in denen man am liebsten jeden einzelnen Satz unterstreichen möchte - so dicht und kenntnisreich argumentiert und formuliert Meinel."
Politik.Wissenschaft, Michael Kolkmann
"In einer verständlichen Sprache geht er den komplizierten Mechanismen des politischen Systems auf den Grund (...) (eine) überzeugende Analyse."
Das Parlament, Aschot Manutscharjan
"Florian Meinel räumt mit Bundestagsklischees auf (...)) erfrischend."
SWR2 Kultur, Klaus Heinrich
"Aus erfreulich großer Distanz zur Aufgeregtheit unserer Zeit beschreibt Meinel nüchtern und einleuchtend, worin die Gefahren und Selbstgefährdungen der parlamentarischen Demokratie liegen. Hochinteressant."
Dresdner Morgenpost, Guido Glaner
"Florian Meinel geht in einer fundierten Analyse dem Doppelcharakter des Parlaments auf den Grund (...) eine lehrreiche Einführung."
Süddeutsche Zeitung, Rudolf Walther
"Florian Meinel schlüsselt anhand der parlamentarischen Institutionen des Grundgesetzes die politische Krise der Gegenwart auf - ein großer Wurf!"
Christoph Möllers
Jens-Christian Raabe, Süddeutsche Zeitung
"Eine pointierte, aber unaufgeregte und an verborgenen Einsichten reiche Analyse."
Recht und Politik, Stefan Lenz
"Florian Meinel untersucht die Mikrostruktur unserer Verfassungsorganisationen und regt zum Nachdenken an."
zdf kultur, Thorsten Jantschek
"Meinel beweist mit seiner lebendig geschriebenen Analyse des parlamentarischen Regierungssystems den Mut und die Gabe, aus dem Schutzschild des juristischen Fachjargons herauszutreten."
Neue Justiz, Katja Gelinsky
"Florian Meinel hat mit ,Vertrauensfrage' ein kluges Buch geschrieben, das vor Augen führt, wie erhellend und spannend ein Blick auf die Mechanismen unseres parlamentarischen Systems sein kann."
Tagesspiegel, Florian Keisinger
"Florian Meinel beantwortet die aktuelle Frage nach der Zukunft der parlamentarischen Demokratie in Deutschland."
Neue Württembergerische Zeitung, Gunther Hartwig
"Thesenstarker Band (...) origineller Aufschlag, in dem nicht davor zurückgeschreckt wird, 'einmal grundsätzlicher und größer zu denken'"
Im Gegenlicht, Karl Adam
"Dieses Buch ist eines von denjenigen Werken, in denen man am liebsten jeden einzelnen Satz unterstreichen möchte - so dicht und kenntnisreich argumentiert und formuliert Meinel."
Politik.Wissenschaft, Michael Kolkmann
"In einer verständlichen Sprache geht er den komplizierten Mechanismen des politischen Systems auf den Grund (...) (eine) überzeugende Analyse."
Das Parlament, Aschot Manutscharjan
"Florian Meinel räumt mit Bundestagsklischees auf (...)) erfrischend."
SWR2 Kultur, Klaus Heinrich
"Aus erfreulich großer Distanz zur Aufgeregtheit unserer Zeit beschreibt Meinel nüchtern und einleuchtend, worin die Gefahren und Selbstgefährdungen der parlamentarischen Demokratie liegen. Hochinteressant."
Dresdner Morgenpost, Guido Glaner
"Florian Meinel geht in einer fundierten Analyse dem Doppelcharakter des Parlaments auf den Grund (...) eine lehrreiche Einführung."
Süddeutsche Zeitung, Rudolf Walther
"Florian Meinel schlüsselt anhand der parlamentarischen Institutionen des Grundgesetzes die politische Krise der Gegenwart auf - ein großer Wurf!"
Christoph Möllers