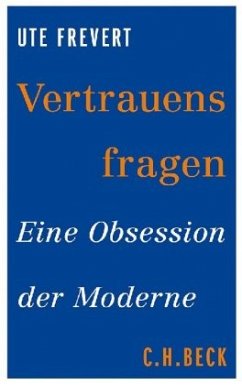"Vertrauen" - kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren eine so rasante Aufmerksamkeits- und Erregungskonjunktur zu verzeichnen. Auf Wahlplakaten und in der Produktwerbung begegnen wir ihm, bei jeder Krise wird sein Verlust alarmierend beschworen. Wo Vertrauen in Frage gestellt wird, da gedeiht rasch eine Kultur des Verdachts und der Rechenschaftspflichten mit langfristig fragwürdigen Folgen. Ute Frevert zeichnet in ihrem Buch zunächst die seltsame Karriere des Vertrauens in der Moderne nach, das seit dem 18. Jahrhundert zunehmend säkularisiert und entmoralisiert wurde. Sie untersucht sodann den Gebrauch des Begriffs in unterschiedlichen Kontexten wie Familie/Freundschaft, Schule, Ökonomie und Wissenschaft. Schließlich wirft sie auch einen kritischen Blick auf die "V-Waffe", den inflationären Einsatz des Vertrauensarguments in der Politik.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein Begriff, der in vielen Lebensbereichen Konjunktur hat - vielleicht in allzu vielen: Die Berliner Historikerin Ute Frevert legt eine Kulturgeschichte des Vertrauens vor
Heinrich von Kleist ließe sich als Dichter des Vertrauens charakterisieren. In seinem Schauspiel "Das Käthchen von Heilbronn" soll dem schwererkrankten Grafen Wetter vom Strahl ein Engel erschienen sein, der an ihn appellierte: "Vertraue, vertraue, vertraue". Und in der Erzählung "Die Verlobung in St. Domingo" ruft die sterbende Toni ihrem Verlobten Gustav zu, der auf sie geschossen hat: "Du hättest mir nicht misstrauen sollen." Vertrauen wird hier als existentiell entscheidende Größe erfahrbar, deren Bedeutung aus dem zeitlichen Kontext von Kleists Werks zu erschließen ist: Die feudale Gesellschaftsordnung und Religion bieten zunehmend weniger Halt; das Subjekt sucht Stärkung und Selbstvergewisserung im Gegenüber.
Die "Obsession der Moderne", als welche die Historikerin Ute Frevert das Vertrauen im Untertitel ihres neuen Buches kennzeichnet, lässt sich hier besonders intensiv erleben, zu einem Zeitpunkt, da der Begriff allmählich eine zentrale Bedeutung in zahlreichen Lebensbereichen gewinnt. Zuvor war er vor allem gebräuchlich im Sinne von Gottvertrauen; Institutionen und Mitmenschen, nicht zuletzt höherrangige, erwarteten Treue. Doch Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beginnt sich dies zu ändern, im Bereich des Zwischenmenschlichen und bald auch im Verhältnis zur politischen Ordnung, schließlich im Ökonomischen, wo zunehmend mehr auf Vertrauen gesetzt und um es geworben wird - ganz selbstverständlich, wie es scheint, doch ohne dass dabei immer klar wäre, ob es berechtigt und was darunter näher zu verstehen sei, wie die Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung darlegt.
Die Historikerin macht die grundlegende Bedeutung des Vertrauens für die moderne Welt transparent, die es zu einem Leitmotiv des sozialen Handelns erhebt. Auf den deutschen Sprachraum beschränkt sie sich mit gutem Grund, ist doch die "Vertrauenskommunikation fundamental an Sprache und Rhetorik gebunden", wie sie schreibt. Zahlreiche Belege sammelt sie auf ihrer historischen Spurensuche und verschweigt nicht, was sie selbst als Manko ihrer Darstellung begreift: Wissenschaft und Kunst werden darin weitgehend ausgespart. Am dichtesten argumentiert die Autorin dort, wo ihr eigentliches Metier, die politische Historie und Sozialgeschichte, zu befragen ist.
Am Beispiel von Richard Wagners Deutung des Lohengrin-Mythos - der Schwanenritter erwartet ebenso gegenseitiges Vertrauen wie die von ihm gerettete Elsa, freilich in je unterschiedlicher Akzentuierung, was tragische Folgen zeitigt - zeigt sich die fürs Vertrauen charakteristische Wechselseitigkeit. Diese unterscheidet es von verwandten Phänomenen oder solchen, an deren Stelle es tritt: Treue lässt sich auch einseitig fordern, ein Gleiches gilt für etwas, auf das man sich schlicht verlässt. Die Zuversicht impliziert keine Reflexion wie das Vertrauen, das dosiert und einer Prüfung unterzogen werden kann. Mit Mitteln einer Theorie rationaler Entscheidung lasse sich das Phänomen nicht erfassen. Denn Vertrauenshandlungen sind immer riskant, was Vertrauensspendern wie -nehmern stets bewusst bleibt.
Die Rationalisierung politischer Prozesse, die Max Weber als Charakteristikum der Moderne beschrieb, findet am Vertrauen eine Grenze. Wobei sie zunächst offenlässt, ob ein Vertrauen, um das Politiker und Parteien werben, dem eigentlichen Charakter desselben noch entspricht. An einem unwandelbaren Bedeutungskern hält sie in ihrer Darstellung nämlich fest: Nähe, Intimität, Offenheit und Transparenz impliziere der Begriff dauerhaft.
Im Zwischenmenschlichen markiert das Konzept der romantischen Liebe den Zeitpunkt, wo das Vertrauen zur bestimmenden Größe wird. Unter Männern entfaltet es seine Wirkung in Freundschaften und kann auch dort eine totale und exklusive Dimension eröffnen, welche im Gegenteil dann leicht Misstrauen befördert: Die Beziehung Richard Wagners zu Friedrich Nietzsche dient Frevert als Beispiel. Ausführlich erörtert sie nicht zuletzt die Bedeutung des Vertrauens in der modernen Pädagogik seit Pestalozzi.
Es versteht sich, dass es in der wirtschaftlichen Sphäre nicht um Vertrauen im emphatischen Wortsinn geht. Doch wem sonst sollte man Kredit gewähren als einer Person, der man vertraut? Schon die Etymologie legt nahe: Kredit impliziert Glauben. Das der Ökonomie mindestens so naheliegende rationale Kalkül führt freilich auch zum Gegenteil, was sich im raschen Wachstum von Auskunfteien, die ihren Kunden Informationen über die Kreditwürdigkeit von Personen verschaffen, bestätigt. Dass auch die intime Note des Vertrauens im Ökonomischen angesprochen werden kann, belegen das sogenannte Konsumenten- und Markenvertrauen. Reaktionen auf geänderte Produktverpackungen bestätigen, wie lebendig Marken zuweilen erscheinen.
Als im neunzehnten Jahrhundert auch in Deutschland demokratische Bestrebungen an Macht gewinnen, macht das auf John Locke zurückgehende Konzept des "Vertrauensstaats" von sich reden. Die Abgeordneten der Frankfurter Bundesversammlung werden "Vertrauensmänner" genannt. Auch in der Weimarer Verfassungsdebatte ist häufig von Vertrauen die Rede. Der nationalsozialistische Sprachgebrauch appelliert dann wieder eher an die alte Treue. In der DDR wird Vertrauen in die Partei gefordert. In der Bundesrepublik werben Politiker wie Willy Brandt und Helmut Kohl um das Vertrauen der Wähler, indem sie sich selbst als vertrauenswürdig darstellen. Und zuweilen stellen Kanzler die Vertrauensfrage, um ihren Rückhalt zu prüfen.
Prosaischen Verhältnissen verleihe der Begriff des Vertrauens poetischen Glanz, so Frevert; er suggeriert Emotionalität und moralisches Verhalten. Seiner anhaltenden Konjunktur ist dieser Umstand sicher zuträglich, auch wenn man sich wohl meistens darüber bewusst ist, dass das tatsächlich Gemeinte seinen Namen oft nur in Maßen verdient. Emotionalität bleibt erst recht im stahlharten Gehäuse der Moderne gefragt, doch Vertrauensseligkeit ist heute keine nützliche Eigenschaft.
THOMAS GROSS.
Ute Frevert: "Vertrauensfragen". Eine Obsession der Moderne. Verlag C.H. Beck, München 2013. 259 S., br., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Was Ute Frevert hier zum Thema Vertrauen vorgelegt hat, ist keine große Studie, baut Johan Schloemann falschen Erwartungen vor, sondern vielmehr eine Ansammlungen von Beobachtungen, Befunden, die mitunter pointiert ausfallen, aber nicht immer ganz tiefgründig. Frevert geht von einer Überbeanspruchung des Vertrauensbegriffs aus, ständig fordern Politiker, Händler oder Werber Vertrauen ein oder sprechen von Vertrauen, wenn es eigentlich um Mehrheiten oder Kaufanreize geht. Nicht immer kann man Schloemann folgen, wenn er etwa vom Vertrauen spricht, dessen Berechtigung durch einen Kontrolldienst wie die Schufa hergestellt werde, vermisst man irgendwie die Anführungszeichen. Aber sehr deutlich wird, dass Schloemann unzählige Belege für eine "semantische Entgrenzung des Vertrauens" gefunden hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH