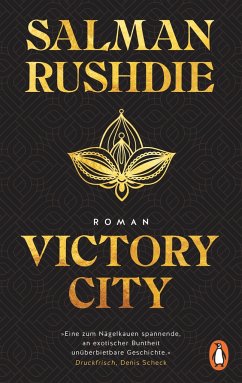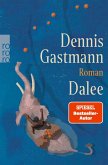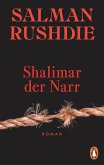Der neue große Roman über Liebe, Macht und die Kraft des Erzählens von Booker-Preisträger Salman Rushdie
Südindien im 14. Jahrhundert: Die neunjährige Waise Pampa Kampana wird von einer Göttin auserkoren, ihre menschliche Hülle und ihr Sprachrohr in die Welt zu sein. In ihrem Namen erschafft Pampa aus einer Handvoll Samen eine Stadt: Bisnaga - Victory City, das Wunder der Welt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte Rolle zu geben. Aber die Schöpfungsgeschichte Bisnagas nimmt mehr und mehr ihren eigenen Lauf. Während die Jahre vergehen, Herrscher kommen und gehen, Schlachten gewonnen und verloren werden und sich Loyalitäten verschieben, ist das Leben von Pampa Kampana untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Von ihrem Aufstieg zu einem Weltreich bis zu ihrem tragischen Fall.
Salman Rushdie erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Südindien im 14. Jahrhundert: Die neunjährige Waise Pampa Kampana wird von einer Göttin auserkoren, ihre menschliche Hülle und ihr Sprachrohr in die Welt zu sein. In ihrem Namen erschafft Pampa aus einer Handvoll Samen eine Stadt: Bisnaga - Victory City, das Wunder der Welt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte Rolle zu geben. Aber die Schöpfungsgeschichte Bisnagas nimmt mehr und mehr ihren eigenen Lauf. Während die Jahre vergehen, Herrscher kommen und gehen, Schlachten gewonnen und verloren werden und sich Loyalitäten verschieben, ist das Leben von Pampa Kampana untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Von ihrem Aufstieg zu einem Weltreich bis zu ihrem tragischen Fall.
Salman Rushdie erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)

Was bleibt, stiften die Dichter, nicht die Gewaltherrscher: Salman Rushdies Roman "Victory City" auf Deutsch
Am besten, man fängt von hinten an: Auf den letzten Seiten seines neuen Romans "Victory City" versammelt Salman Rushdie einige Quellen, die ihn zu diesem inspiriert haben. Es sind mehrere wissenschaftliche Bücher zur Geschichte Indiens darunter, aber auch essayistische wie V. S. Naipauls "Indien - Eine verwundete Kultur". Außerdem eines, dessen Titel fast identisch mit dem von Rushdies Roman ist: "City of Victory". Gemeint ist Vijayanagara, ein hinduistisches Königreich in Südindien mit gleichnamiger Hauptstadt, das bis zur Schlacht von Talikota im Jahr 1565 Bestand hatte. In dieser wurde es von den islamischen Dekkan-Sultanaten vernichtend geschlagen.
In das historische Setting pflanzt Rushdie eine Erzählung, die wie ein Märchen beginnt und sich bald zur Parodie eines großen Epos auswächst. Zwischen einige historische Figuren setzt er eine erfundene Über-Frau mit dem überkandidelten Namen Pampa Kampana, die, so erfahren wir gleich zu Beginn, 247 Jahre alt geworden sein soll und als "Wundertätige", "Prophetin" und mehrfache Königin beschrieben wird. Auf deren vor fast fünfhundert Jahren in einem Tonkrug versiegeltem, jüngst erst wieder ausgegrabenem "gewaltigen Prosagedicht" über den Aufstieg und Fall ihres südindischen Reiches beruhe der vorliegende Roman - dieser sei allerdings "in schlichter Sprache nacherzählt von einem Autor, der weder Gelehrter ist noch Poet, nur jemand, der gern Fäden spinnt und diese Version zur schlichten Unterhaltung und vielleicht auch zur Erbauung heutiger Leser darbietet".
Das ist natürlich maßlos untertrieben, denn Rushdies Erzähler wird, wie man es von seinen Erzählern gewohnt ist, überaus gelehrt und sehr poetisch zu uns sprechen auf den folgenden vierhundert Seiten - und zwar in der Manier der maßlosen Übertreibung. Bei diesem Gegenteil von ökonomischem Erzählen wird nichts weggelassen, sondern alles maximal ausgeschmückt. Rushdie hat es von seinem Frühwerk an über das Meisterstück der "Satanischen Verse" bis zum Meta-Roman "Quichotte" gepflegt, und auch hier treibt er es sofort wieder auf die Spitze. Wenn sein epischer Erzähler etwa eine Nebenfigur abkanzeln will, genügt es ihm nicht, sie kurz als "zweitklassigen König" zu beschreiben. Sondern sie erhält die folgende Satzkaskade: "Diesem zweitklassigen raja blieb auf seinem drittklassigen Thron gerade mal genügend Zeit, eine viertklassige Burg an den Ufern des Flusses Pampa zu bauen, darin einen fünftklassigen Tempel zu errichten und in den Fels eines steinigen Bergs einige vollmundige Inschriften meißeln zu lassen" - und damit ist der Satz noch immer nicht am Ende.
Man kann dies, statt es zu kritisieren, freilich leicht rechtfertigen, hat es doch seine Funktion in Rushdies postmoderner Ästhetik, in der alles, wirklich alles der Parodie dient. Männer und Frauen, Herrscher und Sklaven, Kultur und Krieg, geschichtlicher Fort- und Rückschritt, sämtliche Religionen und Kulte und nicht zuletzt die historischen Textformen, die all dies beschreiben, werden diesem Autor Zielscheibe des Spottes, der Ironie, der grotesken Verzerrung.
In der milden Variante bezieht sich der Spott etwa auf die teils historischen, teils fiktiven Quellen der Erzählung. Erwähnt wird etwa der Bericht eines portugiesischen Reisenden über das Reich Vijayanagara, der im Roman Domingo Nunes heißt. Er weist Parallelen zu Berichten von Domingo Paes und Fernão Nunes aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert auf, die das unter Rushdies Quellen ebenfalls aufgeführte Werk "A Forgotten Empire" eines britischen Kolonialbeamten namens Robert Sewell maßgeblich stützen. Rushdies Erzähler indes spottet über Nunes: "Er fand es interessant, Banalitäten zu vermerken, die regionalen Produkte zu benennen und das Vieh zu beziffern . . ., als wäre er ein Bauer, dabei hatte er nie auch nur einen einzigen Tag auf einem Bauernhof gearbeitet." Mit einer Spitze gegen den Kolonialismus und seine Literatur heißt es ferner, Nunes beschreibe eine Vielzahl von Themen, für die sich die Ortsansässigen nicht interessierten, da sie ihnen längst bekannt waren.
Aber bei mildem Spott bleibt es nicht. Denn das höchste Ziel von Rushdies Parodie scheint es zu sein, die Drastik, den Horror historischer Epen, den wir aus Antike und Mittelalter kennen, noch zu übertreffen. Das zeigt sich an Formulierungen wie der einer "unbedeutenden Schlacht" oder der Erwähnung abgeschlagener Köpfe als Alltäglichkeit, vor allem aber an der Traumatisierung der Hauptfigur im Kindesalter: Da erlebt sie, wie die Frauen ihres "winzigen besiegten Königreichs" Massenselbstmord in den Flammen begehen, "feierlich und klaglos". Von nun an wird sie "mit aller Kraft dafür sorgen, dass Frauen sich nie wieder auf diese Weise verbrennen und dass Männer lernen, Frauen mit neuem Blick zu sehen".
Was Rushdie dann entwickelt, könnte ein feministischer Ritterroman werden, die Utopie eines moderneren und toleranteren Indiens, als es je existierte. In Kampanas Reich herrscht bald sexuelle Freiheit, sogar die Idee des Pazifismus keimt auf, kolonialistische Affen werden vertrieben, eine Dynastie "magischer Mädchen" scheint zu entstehen, und eine chinesische Superheldin verfeinert die Kampfkünste der Frauen, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt und fanatische Sekten und Sultane wieder die Oberhand gewinnen. Auch die Sprache gerät dabei wild durcheinander, neben Kronprinzen und falschen Krishnas sieht man "Möchtegern-Revoluzzer" und einen totalitären "Senat Göttlicher Überlegenheit". Es ist Bernhard Robben zu verdanken, den Roman wirklich übertragen zu haben in ein lesbares Deutsch, was bei den letzten Büchern Rushdies nicht immer der Fall war.
Das bittere Ende steht leider früh fest, der Kursus der Pampa Kampana wird schon durch die vier Teile des Buches klar vorgezeichnet: "Geburt - Exil - Ruhm - Untergang". Noch kurz vor Schluss scheint zwar parabelhaft die Möglichkeit auf, dass "Liebe über Hass triumphiert" und die Vernunft siegt, doch die weise Frau weiß schon, dass die Katastrophe naht, und zwar, weil ein Mann "seinem Wesen gemäß handeln" wird. Der Seherin werden am Ende die Augen ausgebrannt: Eine furchtbare Parallele entsteht da zum Schicksal des Autors Rushdie, der bei dem Attentat im vergangenen Jahr, das er nur knapp überlebte, ein Auge verlor (zuletzt F.A.Z. vom 11. Februar). Aber der Roman war schon vor dem Attentat fertig, und seine ihm überdeutlich eingeschriebene Pointe war auch vorher nicht überraschend angesichts eines Autors, der seit 1989, seit der von Fanatikern gegen ihn verhängten Todes-Fatwa, trotzig die Freiheit des Wortes und der Kunst verteidigt.
Diese Pointe lautet, dass von den schlimmsten Gewaltherrschern am Ende nur Erzählungen bleiben, und die könnten immer neu gestaltet werden: "Worte sind die einzigen Sieger." Klingt romantisch, setzt allerdings voraus, dass die Unterdrückten ihre Worte denn hörbar machen können. Als prominente Stimme spricht Rushdie für viele Unbekannte mit, und die Hoffnung auf Heilung der "verwundeten Zivilisation" (Naipaul) reicht weit über Indien und den Roman hinaus. Dass er nach so viel Zynismus mit Pathos endet, wirkt fast wie eine Erlösung. JAN WIELE
Salman Rushdie:
"Victory City". Roman.
Aus dem Englischen
von Bernhard Robben.
Penguin Verlag, München 2023. 414 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Angesichts der Messerattacke auf Salman Rushdie liest Rezensent Hernán Caro dessen neuen Roman auch als eine Kampfansage: gegen die Gewalt und für die Worte. Das Buch widmet sich zwei Erzählsträngen, erklärt er, auf der einen Seite steht die Entwicklung des historischen Königreichs Bisnaga im Vordergrund, auf der anderen die Geschichte einer göttlich gesegneten Frau names Pampa Kampana. Beide Geschichten werden miteinander verwoben und bewegen sich zwischen Höhenflug und Tragödie hin und her, so der Kritiker. Caro erzählt einen großen Teil der Handlung nach, um zu verdeutlichen, wie intensiv, verspielt und fantasievoll sich Rushdies Erzählkunst hier zeigt, die aber manchmal auch zu sehr auf den Effekt hin geschrieben zu sein scheint. Ein wenig sauer stößt ihm auch das Diktum auf, der Autor habe eine "weibliche Perspektive" einnehmen wollen, werden genau jene doch eher anhand äußerlicher Attribute bemessen. Die intellektuelle und magische Kraft von Pampa Kampana und den Worten, mit denen sie den Bewohnern des Königreichs Leben einhaucht, können den Kritiker aber doch überzeugen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Eine zum Nägelkauen spannende, an exotischer Buntheit unüberbietbare Geschichte. Eine Parabel über Macht und Machtmissbrauch und eine Erzählung von Liebe und Tod.« Denis Scheck in ARD »druckfrisch«