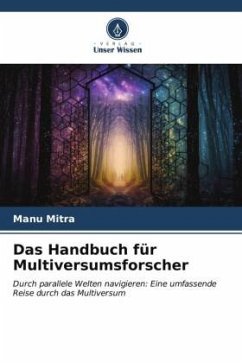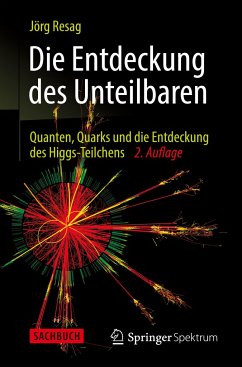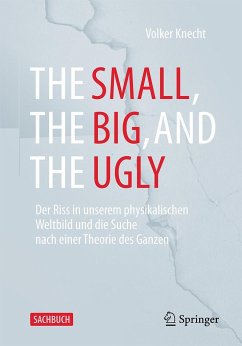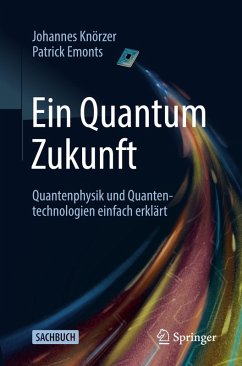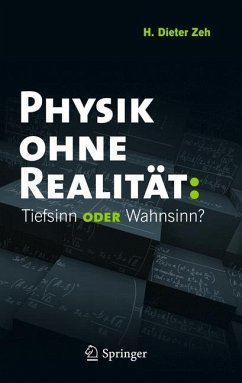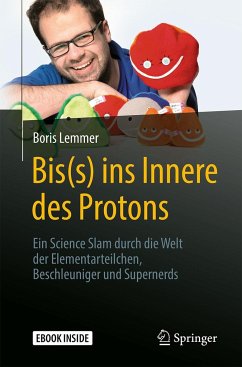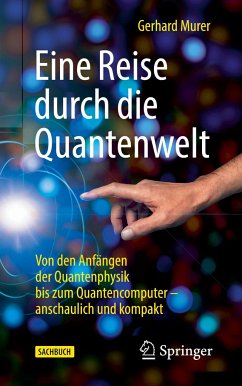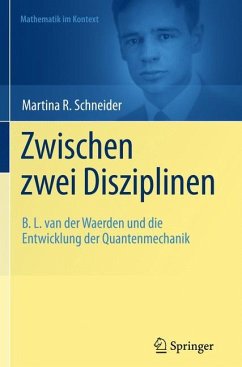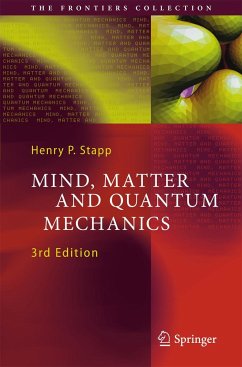Viele Welten
Hugh Everett III - ein Familiendrama zwischen kaltem Krieg und Quantenphysik

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Peter Byrne erzählt die Lebensgeschichte von Hugh Everett III (1930-1982), dessen "viele Welten" Theorie der multiplen Universen die Physik und Philosophie entscheidend beeinflusst hat. Anschaulich und für das breite Publikum zugänglich entwirft Byrne ein detailliertes Porträt des Genies, das eine erstaunliche Methode erfand, unser komplexes Universum von Innen zu beschreiben. Byrne verwendet hierbei bisher unveröffentlichte Schriften von Everett (die kürzlich im Keller seines Sohn entdeckt wurden) und zahlreiche Interviews mit Freunden, Arbeitskollegen und noch lebenden Familienmitglied...
Peter Byrne erzählt die Lebensgeschichte von Hugh Everett III (1930-1982), dessen "viele Welten" Theorie der multiplen Universen die Physik und Philosophie entscheidend beeinflusst hat. Anschaulich und für das breite Publikum zugänglich entwirft Byrne ein detailliertes Porträt des Genies, das eine erstaunliche Methode erfand, unser komplexes Universum von Innen zu beschreiben. Byrne verwendet hierbei bisher unveröffentlichte Schriften von Everett (die kürzlich im Keller seines Sohn entdeckt wurden) und zahlreiche Interviews mit Freunden, Arbeitskollegen und noch lebenden Familienmitgliedern. Everetts mathematisches Model ("Universal Wave Function") beschreibt alle denkbaren Ereignisse als "gleichwertig real" und folgert, dass endlose Kopien jedes Menschen und Gegenstandes in allen nur denkbaren Strukturen existieren, die sich über endlose Universen erstrecken: viele Welten. Everett, gezeichnet von Depressionen und Sucht, strebte danach, eine rational Ordnung in jene Wissenschaftsbereiche zu bringen, in denen ihm historisch bedeutende Rollen zukamen. Neben seiner berühmten Interpretation der Quantenmechanik verfasste Everett eine klassische Arbeit zur Spieltheorie. Zudem entwickelte er Computeralgorithmen, die die Forschung im Bereich der Militäreinsätze revolutionierten, und leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz für streng geheime Regierungsprojekte. Ferner schrieb Everett die Grundsoftware zur Anzielung von Städten in einem Nuklearkrieg und er gehörte zu den ersten Wissenschaftlern, die die Gefahr des nuklearen Winters erkannten. Als Kalter Krieger entwickelte er logische Systeme, die die "rationalen" Verhaltensweisen von Mensch und Maschine darstellten, und war sich dennoch weitestgehend nicht des emotionalen Schadens bewusst, den sein eigenes irrationales Verhalten seiner Familie und seinen Geschäftspartnern zufügte. Everett starb sehr früh, hinterließ jedoch ein faszinierendesLebenszeugnis, einschließlich des Schriftverkehrs mit solch philosophisch geprägten Physikern wie Niels Bohr, Norbert Wiener und John Wheeler. Diese außergewöhnlichen Briefe werfen Licht auf Everetts langwierige und oftmals schmerzliche Anstrengungen, das Messproblem im Herzen der Quantenphysik zu erklären. In den letzten Jahren gewann Everetts Lösung für dieses mysteriöse Problem - die Existenz eines Universums von Universen - beachtlichen Zuspruch in Wissenschaftskreisen, nicht als Science Fiction, aber als Erklärung der physikalischen Realität.