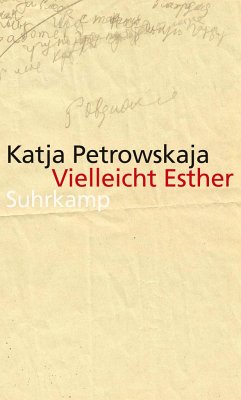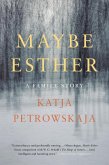Hieß sie wirklich Esther, die Großmutter des Vaters, die 1941 im besetzten Kiew allein in der Wohnung der geflohenen Familie zurückblieb? Die jiddischen Worte, die sie vertrauensvoll an die deutschen Soldaten auf der Straße richtete - wer hat sie gehört? Und als die Soldaten die Babuschka erschossen, »mit nachlässiger Routine« - wer hat am Fenster gestanden und zugeschaut? Die unabgeschlossene Familiengeschichte, die Katja Petrowskaja in kurzen Kapiteln erzählt, hätte ein tragischer Epochenroman werden können: der Student Judas Stern, ein Großonkel, verübte 1932 ein Attentat auf den deutschen Botschaftsrat in Moskau. Sterns Bruder, ein Revolutionär aus Odessa, gab sich den Untergrundnamen Petrowski. Ein Urgroßvater gründete in Warschau ein Waisenhaus für taubstumme jüdische Kinder. Wenn aber schon der Name nicht mehr gewiß ist, was kann man dann überhaupt wissen? Statt ihren gewaltigen Stoff episch auszubreiten, schreibt die Autorin von ihren Reisen zu den Schauplätzen, reflektiert über ein zersplittertes, traumatisiertes Jahrhundert und rückt Figuren ins Bild, deren Gesichter nicht mehr erkennbar sind. Ungläubigkeit, Skrupel und ein Sinn für Komik wirken in jedem Satz dieses eindringlichen Buches.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ein Märchen, ein Roman? Für Samuel Moser ist das Buch von Katja Petrowskaja beides, und zwar im besten Sinne. Wie die Autorin durch das 20. Jahrhundert hindurch, durch Kiew, Berlin, Warschau, Moskau, unerschrocken und unvoreingenommen die Spuren ihrer Vorfahren, besonders derer, die dem Holocaust zum Opfer fielen, verfolgt, findet Moser bewundernswert. Beeindruckend scheint ihm, wie die genauen Bilder, die Petrowskaja findet, metaphysische Horizonte eröffnen, sodass Gewalt und Tod erahnbar werden und das Verschwinden in der Geschichte reversibel scheint. Dass die Autorin bei aller Genauigkeit keine Antworten anpeilt, sondern Nichtwissen und Leere zulässt, macht die Lektüre für Moser zu einer buchstäblich traumhaften Erfahrung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie ich, gemeinsam mit zahlreichen Übersetzern aus aller Welt, versuchte, das fremde Deutsch meines Romans "Vielleicht Esther" in alle anderen Sprachen zu verwandeln
Von Katja Petrowskaja
Bomben sind überall Bomben, nicht nur im Deutschen, Französischen, Englischen, sondern auch im Ungarischen und Finnischen - das einzige Wort, das uns eint und daher problemlos zu übersetzen, das war die erste Überraschung der Übersetzerwerkstatt in Straelen, fast an der holländischen Grenze. "Das Schwierigste bei diesem Text ist die Intonation", meinte Wil aus Holland, ja genau, "il respiro del libro", sagte Ada aus Italien. Dreizehn Übersetzer waren nach Straelen gereist, diesem Mekka für Übersetzer, um sich mit meinem Buch "Vielleicht Esther" zu beschäftigen.
Bisher haben sie Franz Kafka und Thomas Mann, Arthur Schopenhauer und Robert Walser, Judith Schalansky und Uwe Tellkamp übersetzt, und nun war ich an der Reihe. Ich fühlte mich geehrt und war eingeschüchtert, doch insgeheim (war es Anmaßung oder Täuschung?) dachte ich, dass mein leises Buch noch schwieriger zu übersetzen sei als zum Beispiel die Texte von Robert Walser. Zumindest konnte er wirklich Deutsch (obwohl, Moment!), doch ich kann nur fast Deutsch, die Worte sitzen oft nicht ganz bequem an ihrem Platz, sie zittern leicht, als würde die Sprache nach etwas verlangen. Eigentlich müsste man auch in diesem Text hier ein paar Fehler drin lassen, meint meine Tochter, sonst wird dir niemand glauben, dass du es schwer hast. Oft spüre ich, und so schreibe ich weiter, wie jedes Wort sich freut, wenn ich für ihn ("für es", sagt meine Tochter) den richtigen Platz finde, ich kenne diese aufflatternde Dankbarkeit der Wörter. Aber wie übersetzt man dieses Flattern?
In Wahrheit nämlich ist schon der deutsche Text meines Buchs eine Übersetzung, so tröstete ich die Übersetzer, das Original fehlt leider, es hätte auf Russisch geschrieben werden müssen oder in beiden Sprachen gemischt, aber es ist nicht vorhanden. "Wo ist denn der russische Übersetzer?", fragte jemand. Den gibt es nicht, sagte ich, das Buch ist in der Spannung zwischen den Sprachen entstanden, zwischen den Diskursen, zum Beispiel zwischen der Sprache der deutschen Aufarbeitung und der Sprache der russischen Kriegsrhetorik. "Dann müssen wir uns von unserer eigenen Sprache entfremden", sagte Ilona aus Finnland, ohne mit der Wimper zu zucken.
Zeile für Zeile bewegten wir uns durch die Kapitel, langsamer als Schildkröten. Zum ersten Mal verstehe ich, dass ich bereits vieles verloren hatte, als ich russische Rhythmen hörte und auf Deutsch schrieb. Wie kann man Verluste in Gewinne ummünzen? Der Prolog spielt am Berliner Hauptbahnhof, und erst jetzt, zusammen mit den Übersetzern, begriff ich, dass das Schlüsselmotiv von einem russischen Wort ausgelöst worden war. Das Wort "Bahnhof" heißt auf Russisch "woksal", es ist abgeleitet von einem berühmten Konzertsaal im Londoner Stadtteil Vauxhall - Vox, Stimme, Voxsaal, ein Saal für Stimmen, etymologisch falsch, poetologisch ein Geschenk, denn es ruft so viele Verbindungen auf wie Mandelstams tautologisch betiteltes Gedicht "Konzert na Voxsale", Konzert im Stimmensaal. Die Reise im Buch ist also eine Stimmprobe, es geht um die Suche nach einem Resonanzraum, eine Suche nicht nur nach sich selbst, sondern nach den und dem Anderen, nach einer anderen Rolle und einem anderen Schicksal, obwohl ich in diesem Prolog nur von Berlin nach Polen fahre, auf der Suche nach meiner eigenen Familie.
Auch das russische "strelka", Pfeil, verbindet eine ganze Kette von deutschen Wörtern: Der Zeiger eines Geräts, der Weichensteller am Bahnhof, der Pfeil, der Achilles trifft, ja selbst das Wort "schießen", das in meinem Buch viel zu oft vorkommt, sie alle gehen im Russischen auf dieselbe Wurzel zurück: strelka, strelochnik, strela, streliat. Sie erschaffen ein Motiv der Bewegung, ein Umschalten, einen Seitenwechsel, Maß und Schuld, und sie umklammern den Text auf der morphologischen Ebene - aber nur auf Russisch, im Deutschen sind diese Assonanzen weder hör- noch sichtbar. Wie übersetzt man dieses Dazwischen, diese Funktion des Weichenstellers?
Aimée aus Schweden musste für meine "Blumenomas" Rosa und Margarita, meine Großmütter väterlicher- und mütterlicherseits, das Wort "Blumenbabuschkas" erfinden, denn das Schwedische verlangt die genaue Benennung der Verwandtschaft. Auf Finnisch ist zwar Rosa eine Blume, Margarita aber nicht, deswegen kann man die ganze Pflanzenbesessenheit dieser Passage im Finnischen nicht nachvollziehen. "Haben Sie es schon mit Latein probiert?", fragte Aimée ihre finnische Kollegin.
Doch gerade das Finnische erweist sich als Gewinn. "Mit der Wendung Verluste, die mit keinem Zug einzuholen sind: Meinst du hier Zug im Sinn von Eisenbahn?", fragte Ilona. "Du schreibst über den Durchzug auf dem Bahnhof, das ist auch ein Zug, und denkbar wäre auch ein Zug im Schachspiel." Auf einmal wird etwas sichtbar, das mir bisher entgangen ist, denn im Buch gibt es auch Züge ohne Ankunft und Spiele ohne Sieger, und es gibt den Durchzug der Geschichte, obwohl man das so nicht sagen kann.
Die hör- und sichtbaren Schwierigkeiten waren sofort klar: "die Ödnis öffnet sich", "das Land zitterte und rezitierte", "die Ferne der Fragen" oder "dieses kuschelige Wort koscher". Manchmal sah es aus, als sei die Lösung einfach, aber gerade dann führte sie in die Irre. "Wer nicht lügt, kann nicht fliegen." Wenn man die Konsonanten dieses "lügt-fliegen" verliert, lg-f-lg, wird der Satz prätentiös und zu gewichtig, aber wenn man sich im Englischen vom vollen Reim "lie-fly" fangen lässt, entsteht schlicht Kitsch. Der rumänische Übersetzer Alessandru war sich sicher: Man muss sich dem Duktus des Satzes anvertrauen, dann wird auch die Lautstruktur. Aber was macht man mit dem "versprochenen Versprechen" einer Dame im Bus, die mir statt "Gute Weiterreise" "Gute Weltreise" wünscht und damit ein ganzes Narrativ erzeugt? Verliert man diese Worte, gibt es nichts zu erzählen, denn sie sind die wahren Helden des Texts. In diesem Fall entscheiden wir uns, das deutsche Wort beizubehalten, wie auch in jenen Fällen, die wie Wortspiele aussehen, aber keine sind, zum Beispiel gerettet und Gerät. Mit dem Kopiergerät wird ein unbewusster, aber leidenschaftlicher und zugleich lächerlicher Versuch unternommen, Menschen zu retten - eine Haltung, ein Ansinnen, das sich allein aus den Klängen ergibt, ein im Buch entstehender Glaube, dass Klänge retten können. Aus dem Fikus wächst die Fiktion, das Einzige, das manchmal Leben stiftet, das Einzige, das das Leben erklären kann. Was ist in solchen Fällen wichtiger, fragten die Übersetzer: der Klang oder der Sinn?
Wie findet man Analogien für Gedenkformeln oder ideologische Sprüche, für Losungen wie "niemand ist vergessen", die auf Deutsch schon schräg klingen? Erst will ich alles erklären: dass die Ödnis um den Berliner Hauptbahnhof aus der Leere um den Potsdamer Platz in Wim Wenders' Film "Himmel über Berlin" und Thomas Eliots "Waste Land" entstanden ist, mixing memory and desire, warum hier "Casablanca" mit "Play it again" hineinspielt, wie viel Puschkin und wie viele missbrauchte Utopien der Sowjetunion, dann sprach ich über Bulat Okudzawa, einen Liedermacher, und es löste eine Diskussion darüber aus, wie viel ein Übersetzer wissen muss, um einem Text gerecht zu werden.
Ada brachte uns mit ihrer Akribie schließlich wieder auf den Boden zurück, denn der nächste Satz ist für Italiener zu lang.
Ada: Die Zeichensetzung mit den vielen Kommas ist schwierig. Im Deutschen signalisiert das Verb das Ende des Satzes, aber in den "lateinischen" Sprachen ist es oft unklar, wohin ein Satzteil gehört, deshalb benutze ich gelegentlich ein Semikolon, um anzudeuten, dass hier ein Abschluss ist.
Ich: Aber diese Unklarheit ist auch ein Mittel, die Verlorenheit zu zeigen, ein Zeichen auch für den Sprachverlust oder für die Verlorenheit, wenn man nicht weiß, wohin die Sprache einen führt.
Wil (Niederlande): Diese Verlorenheit ist der Kern des Buches, Semikolon und Punkt ergäben einen Stakkato-Text.
Imre (Ungarn): Ich habe auch gelegentlich ein Semikolon gesetzt, aus Rücksicht, damit sich der Leser in der Verlorenheit nicht selbst verliert. Er soll die Übersicht darüber behalten, wie man sich verliert. Der Leser gesteht dem Autor viel weitreichendere Lizenzen zu als dem Übersetzer.
Ich: Warum denken Sie, dass der Autor weniger verloren sei als der Leser? Ich muss auch jedes Mal suchen, wo man atmet im Satz.
Nicolás (Argentinien): Das Semikolon ist in den romanischen Sprachen viel üblicher und nicht so feierlich wie im Deutschen.
Sergio (Brasilien): Wichtig ist doch, dass die Verlorenheit ausgedrückt wird, aber wie - dafür haben die Sprachen unterschiedliche Mittel.
Ich: Auf Russisch wirkt das Semikolon nur bürokratisch.
Sogar das Wort Glück schenkte uns keine Ruhe. "Welches Glück meinst du?", fragt Ada, die Übersetzerin von Sebald und Canetti, die eine Doktorarbeit über die Ethik in "Der Mann ohne Eigenschaften" geschrieben hat. "Fortuna oder felicità?" Und ich war so froh gewesen, dass man auf Deutsch damit spielen kann, weil man es nicht unterscheiden muss. "Arnold im Hemd" heißt ein Kapitel, wie "Hans im Glück", denn auf Russisch sagt man von einem Glückspilz, er sei "im Hemd geboren". In Bulgarien und in der Slowakei jedoch, so erfahre ich nun, wird er mit der Mütze geboren.
Einige Worte ergeben mehr Sinn, als man von ihnen erwartet, andere üben Gewalt aus, weit und breit, wie Bombardier am Berliner Hauptbahnhof. In Deutschland nimmt man die schrecklichsten Wörter so selbstverständlich in den Mund, als wäre es ein Stück Pizza. Im Kapitel "Das Tor" fahre ich 1989 aus der Sowjetunion mit einer Touristen-Gruppe im Bus nach Polen und auch nach Oswieçim. Ich habe bewusst den polnischen und nicht den deutschen Namen des Ortes hingeschrieben, nicht nur, weil ich damals die deutsche Bezeichnung gar nicht kannte, sondern weil es für uns ein anderer Ort ist und auch weil man das deutsche Wort zu oft benutzt und ohne Scheu. Die deutschen Leser werden die Passage verstehen, aber die argentinischen? "Sie sollen mir doch erlauben, dass ich hier Auschwitz schreibe!", sagt Alessandru aus Rumänien. "Nein, das kann ich nicht zulassen! Dass wir es nicht nennen, ist das Wichtigste überhaupt, denn wer es nennt, macht mit!" Auch der Spruch, der über dem Tor steht, wird im Text aufgerufen, aber nicht genannt, die Wörter "frei" und "Arbeit" kommen vor, doch in anderem Zusammenhang. "Okay", sagt Alessandru, "Auschwitz werde ich nicht nennen, aber ,Arbeit macht frei' muss sein, denn wenn ich Ihnen etwas Unangenehmes über die Rumänen sagen darf: Arbeit spielt bei uns keine große Rolle, wir verbinden nicht viel mit diesem Wort." Aber mir ist es wichtig, die Sprache der Gewalt infrage zu stellen, als ließe sich damit die Gewalt aufheben. Wir lassen die Frage offen.
Doch jedes Mal, wenn wir uns zwischen den Sprachen verirren, gibt es jemanden, der uns aus diesem Wald herausholt. Diesmal ist es Nicolás, wir suchen nach der Übersetzung des Worts Haarnadel im Kapitel "Ariadnefaden", das sich mit Gekritzel, Gewebe beschäftigt. "Das Wort Wünschelrute übrigens bedeutet auf Spanisch auch Haarnadel, horquila", sagt Nicolás. Im Buch ist "Wünschelrute" der Titel des schwierigsten Kapitels, es handelt von der Eroberung der deutschen Sprache. Ich habe mich auf Deutsch nicht ausgetobt, das Deutsche hat mich viel eher gezügelt, diszipliniert, mir überhaupt ermöglicht, ein Narrativ zu kreieren, eine Formbildung. Vielleicht ist es sogar einfacher, das Buch in eine fremde Sprache zu übersetzen als zurück ins Russische?
Auf Russisch müsste ich den Blickwinkel ändern, die Perspektive umdrehen, den Drang nach Osten in den Drang nach Westen übersetzen, denn dort sind bekanntlich andere Wunden und andere Defizite im Spiel. Heute wird auch das Wort Frieden wieder missbraucht, für den Frieden führt man Krieg. Wir dachten, wir sitzen hier im idyllischen Straelen weit ab vom Weltgeschehen, doch der Ort liegt nur zehn Fahrradminuten von jenem kleinen holländischen Städtchen entfernt, das immer noch um seine vielen Opfer trauert, um Menschen, die mit dem malaysischen Flugzeug flogen, das von russischen Separatisten in der Ukraine abgeschossen worden ist. Haben die Bomben das letzte Wort?
Katja Petrowskajas "Vielleicht Esther. Geschichten" ist 2014 im Suhrkamp-Verlag erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Selten wurde eine Familienrecherche, und es gibt ihrer inzwischen ja unzählige, derart spannend und bisweilen tränentreibend dargeboten. ... Als Romanfiktion wäre es überladen und unglaubwürdig, würde es konstruiert wirken. So ist es große Literatur geworden.« Volker Hage DER SPIEGEL 20140317
»Völlig zu Recht erhielt die Autorin für diese souveräne Erinnerungsreise in eine imaginierte Zone des Schreckens den Ingeborg-Bachmann-Preis.«