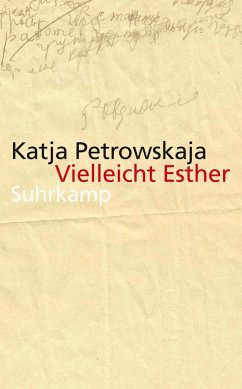Google sei Dank
Die in Kiew geborene, russischsprachige Autorin Katja Petrowskaja hat mit «Vielleicht Esther» ein Buch vorgelegt, das ausdrücklich nicht als Roman firmiert, sondern der Rubrik «Geschichten» zugeordnet ist. Mit der gleichnamigen Geschichte aus diesem Band hat sie 2013 das Wettlesen
um den renommierten und hochdotierten Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt gewonnen. «Ich…mehrGoogle sei Dank
Die in Kiew geborene, russischsprachige Autorin Katja Petrowskaja hat mit «Vielleicht Esther» ein Buch vorgelegt, das ausdrücklich nicht als Roman firmiert, sondern der Rubrik «Geschichten» zugeordnet ist. Mit der gleichnamigen Geschichte aus diesem Band hat sie 2013 das Wettlesen um den renommierten und hochdotierten Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt gewonnen. «Ich habe alles so aufgeschrieben, wie es passiert ist. Es ist leider eine wahre Geschichte» erklärte die seit 1999 in Berlin lebende Autorin, die mit ihrer Kolumne «Die west-östliche Diva» in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als Journalistin bekannt geworden ist.
Es geht in ihrem Debüt um ihre Herkunft und Biografie, um die Geschichte ihrer Familie, die sich unversehens zu einem ergreifenden Spiegelbild einer ganzen Epoche erweitert, dem unheilschwangeren zwanzigsten Jahrhundert, dem Säkulum der Massenmorde. In einer hartnäckig verfolgten Recherche, die sie in Berlin beginnend nicht nur nach Warschau, Moskau und Kiew führt, sondern auch nach Auschwitz und Mauthausen, stöbert sie, alle modernen Mittel der Kommunikation nutzend, nimmermüde entfernte Verwandte und Zeitzeugen auf, ehemalige Nachbarn, Kollegen, Mithäftlinge, durchforscht staubige Archive ebenso wie das Internet. «Google sei Dank» heißt denn auch gleich die Überschrift der als Einleitung fungierenden ersten Geschichte, die sich am Berliner Hauptbahnhof abspielt. «Manchmal ist es gerade die Prise Dichtung, welche die Erinnerung wahrheitsgetreu macht» schreibt sie an einer Stelle, und in der Tat, die Erinnerungen sind brüchig nach so vielen Jahren und bedürfen fiktionaler Ergänzung.
So erinnert sich ihr Vater nicht mehr genau an den Namen der Urgroßmutter. «Vielleicht Esther» sagt er, und die Autorin erzählt die beklemmende Geschichte, wie die von ihrem Vater nur Babuschka genannte Greisin 1941 bei der Flucht vor den deutschen Truppen, weil sie dafür schon zu gebrechlich war, ganz allein in der Wohnung in Kiew zurückgelassen werden musste. Und wie «Vielleicht Esther» dann dem Aufruf der Besatzer zum Abtransport nachkommen wollte, einen Soldaten auf Jiddisch ansprach und gleich auf offner Straße erschossen wurde, während alle anderen ihren Tod in Babi Jar fanden. Es waren 33.771 Juden, die in dieser Schlucht am 29. und 30. September erschossen wurden, wie die Nazis mit groteskem buchhalterischem Eifer notierten. In dem aufsehenerregenden Roman «Die Wohlgesinnten» von Jonathan Littell, sei hierzu noch angemerkt, wird das schreckliche Geschehen dort aus der Täterperspektive beschrieben. Und nicht minder grauenvoll sind die Untaten während der Ära Stalins, von denen Katja Petrowskaja auch berichtet. Damals hätte man eifrig versucht, erfahren wir, durch Pfropfen neue Apfelsorten zu züchten, «gleichzeitig wurde zielstrebig an der Reduzierung der Menschentypen gearbeitet». Ihr Großonkel verübte 1932, dem Herostratos-Syndrom erliegend, ein Attentat auf einen deutschen Botschaftsrat in Moskau, der aber nur verletzt wurde. Nach einem gut dokumentierten Prozess wurde der meschugge Onkel zum Tode verurteilt, die wahren Hintergründe aber wurden nie aufgeklärt. Ein Urgroßvater wiederum gründete in Warschau ein Waisenhaus für taubstumme jüdische Kinder, über mehrere Generationen hinweg waren deshalb viele Vorfahren der Autorin als Lehrer solcher Kinder tätig.
In sechs Kapiteln mit 72 erfreulich schnörkellosen Geschichten entsteht das mosaikartige Familienbild einer eifrigen Ahnenforscherin, die klug und mit fein durchscheinender Ironie aus dem Abstand vieler Jahrzehnte erzählt, was eigentlich unerzählbar ist. Und ernüchtert feststellt: «Geschichte ist, wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt, die man fragen kann, sondern nur noch Quellen». Man folgt der Autorin gerne bei ihren spannenden Recherchen, sie zieht darüber hinaus ihre Leser mit einer assoziationsreichen Sprache in Bann, die noch lange nachklingt.