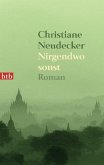Endlich im Taschenbuch: der Bestseller von einer jungen deutschsprachigen Autorin.
Ein großer Familienroman, der anekdotisch, lebendig und eindringlich vom Geschick eines jüdischen Familienclans in Wien erzählt. Sei es Königsbee, der noch jede Redewendung verballhornt hat, sei es die Mutter, die überm Kartenspiel beinahe die Geburt des Sohnes versäumt - die Lebensfäden der verschiedensten Menschen werden über räumliche Trennung hinweg, durch die Schrecken der Naziherrschaft und über die Familienstreitereien nach dem Krieg zusammengeführt im charmanten Wien der Kaffeehäuser.
Ein großer Familienroman, der anekdotisch, lebendig und eindringlich vom Geschick eines jüdischen Familienclans in Wien erzählt. Sei es Königsbee, der noch jede Redewendung verballhornt hat, sei es die Mutter, die überm Kartenspiel beinahe die Geburt des Sohnes versäumt - die Lebensfäden der verschiedensten Menschen werden über räumliche Trennung hinweg, durch die Schrecken der Naziherrschaft und über die Familienstreitereien nach dem Krieg zusammengeführt im charmanten Wien der Kaffeehäuser.
"Daß Eva Menasse ihr Handwerk beherrscht, spürt man in jedem Satz." Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Bestens amüsiert hat sich Rezensent Peter Demetz bei der Lektüre des Familienromans "Vienna" der FAZ-Redakteurin Eva Menasse. In der Geschichte von Menasses Wiener Familie mit ihren Vorfahren im jüdischen Polen und im christlichen Mähren-Schlesien geht es zu wie in einem guten Woody-Allen-Film, meint er. Da ist es ihm auch einerlei, dass die "Pointen mehr zählen" als die Handlung. Gelungen erscheint ihm Menasses Darstellung des jüdischen Aspekts der Familie. Sie gestatte dem Leser, "Juden endlich wieder als Komödienfiguren" wenn auch mit Hintergrund zu sehen. Daneben bescheinigt er der Autorin Selbstironie sowie einen überzeugenden Umgang mit dem Wiener Idiom, das eine eigene Klassen- und Bezirksstruktur aufweise. Nützlich findet Demetz dabei auch den kleinen Katalog im Anhang, der viele Wiener Ausdrücke erklärt. Das wienerische Wort "Goschn" bleibe dem Leser allerdings vorenthalten. Und so erklärt er, was es bedeutet: "scharfe Zunge".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Roman "Vienna" handelt von einer jüdischen Familie im Wien des letzten Jahrhunderts und von lebensrettenden Anekdoten
Das ist doch mal ein Anfang: "Mein Vater war eine Sturzgeburt." So beginnt der erste Roman von Eva Menasse, der in diesen Tagen erscheint. Was für ein erster Satz. Da ist schon alles drin: die Rasanz, das Sich-Hineinstürzen ins Leben, eine gewisse Leichtfertigkeit jenes Vaters, der offensichtlich nicht vorhat, aus dem Vorgang der eigenen Geburt eine große Sache zu machen. Und der zu sagen scheint: Hier bin ich. Wo ist das Leben? Wo kann ich mich melden? Kann bitte die Geschichte meines Lebens jetzt und gleich beginnen?
Und sie beginnt, wie schon lange keine Geschichte einer deutschen Autorin mehr begonnen hat. Sofort sind wir mittendrin in einem Kaffeehaus in Wien, Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Gebärende ist keineswegs gewillt, ihre Partie Bridge wegen dieser lästigen Geburtssache zu beenden. Irgendwann muß es dann aber sein. Doch dann geht alles sehr schnell, die Hebamme kommt zu spät, der Mann, eben erst von seiner Geliebten gekommen, steht hilflos dabei, der Pelzmantel ist verdorben, sie haßt das Kind. Es ist ein Jammer. Und sie und ihr Mann reden und streiten und streiten, während der kleine, neue, blutige Mensch seinen Kopf aus dem Pelzmantel steckt, mit dem sich die Mutter schamvoll einhüllt. Denn das ist das über alle Streitigkeiten und Lebensunglücke hinaus verbindende Element der ganzen großen Familie, die die gut vierhundert Seiten des Romans bevölkert: quatschen, streiten, Anekdoten sammeln und Anekdoten weitergeben. Immer dieselben und immer wieder neue Geschichten aus einem scheinbar unendlichen Familiensagenschatz. "M M" nennt sich dies verbindende, zusammenschweißende Plaudergeheimnis im Kreise der Familie: "Manisches Mythologisieren". Und dabei ist es von zweitrangiger Bedeutung, wie wahr die Geschichten sind. Hauptsache, sie sind gut erzählt. Gute Regel, auch für einen Roman.
Halb Jude, halb nicht
Es ist die Geschichte einer halbjüdischen Familie im Wien des letzten Jahrhunderts. Und in diesem "halb" steckt der Kern der ganzen Geschichte. Der Kern der Erzählung. Der Großvater der Ich-Erzählerin ist Jude, die Großmutter sudetendeutsche Katholikin. Die drei Kinder sind . . . Tja. Spätestens ab 1938 ist das in Wien eine Frage des Überlebens. Auf jeden Fall werden die Kinder zur Sicherheit nach England verschickt. Die Eltern bleiben. Die Gesetze sagen, Juden in Mischehen seien geschützt. Doch die Gesetze können sich auch wieder ändern. Und je länger der Krieg dauert, desto unwichtiger werden Gesetze. Immer wieder hören die beiden von Deportationen auch von Mischehen-Juden. Am Anfang verläßt sie noch bei Fliegerangriffen die Wohnung, um sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen. Er darf natürlich nicht und bleibt allein zurück. Irgendwann geht sie auch nicht mehr in die Bunker. Und im Roman steht nur der Satz: "Zu diesem Zeitpunkt waren meine Großeltern schon lange ganz allein auf der Welt." Was für ein trauriger, kleiner, großer Satz.
Das ist die Kunst der Erzählerin Eva Menasse. Das Schweigen im rechten Moment. Plötzlich ist eben einfach Schluß mit Anekdotenreigen. Der Tod der Mutter des Großvaters wird fast schon unterkühlt registriert. "Sie hat in Theresienstadt dann keine große Mühe mehr gemacht, denn sie überlebte die anstrengende Zugfahrt nur um einundzwanzig Tage." Zuvor, die Abfahrt des Zuges, ist eigentlich die dramatischste Szene, die man sich vorstellen kann. Ihr Sohn, der Großvater der Ich-Erzählerin, hat von ihrem Abtransport erfahren. Er eilt zum Bahnhof. Der Zug ist noch da. Aber wir erfahren nicht, ob er seine Mutter noch ein letztes Mal sieht. Nichts davon. Statt dessen eine Stimme, die ruft: "Kannst gleich mitfahren, Saujud!", und jemand stößt ihn hinein, in den Todeswaggon. Mit größter Mühe kommt er wieder heraus und bleibt auf dem Bahnsteig liegen. Der nächste Absatz beginnt dann damit, daß sich die Großeltern zu Kriegsende wieder stritten wie früher. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Für "meine Großeltern", wie sie im Roman immer heißen.
"Mein Großvater", "meine Großmutter", "mein Vater", "mein Bruder". So heißen die namenlosen Protagonisten des Romans. Das wirft die Frage auf: Wer spricht? Ein rätselhaftes Ich, gleichfalls namenlos, ohne Eigenschaften, ohne Meinung, ein Alles-Beobachter, um den sich niemand zu kümmern scheint. Ein Rätsel. Eine Leerstelle. Wer?
Eva Menasse hat sich für unser Treffen den österreichischsten Ort Berlins ausgesucht. Das Café Einstein in der Kurfürstenstraße. "Weil es da immer einen Parkplatz gibt", sagt sie. Sentimentalität, sachlich begründet. Eva Menasse wurde 1970 in Wien geboren, sie begann als Journalistin für das österreichische Nachrichtenmagazin "Profil", wechselte dann zu den Berliner Seiten dieser Zeitung, für die sie später als Kulturkorrespondentin aus Wien berichtete. Als sie sich von dieser Aufgabe vor mehr als zwei Jahren beurlauben ließ, um an dem Roman zu schreiben, kam sie wieder nach Berlin. In Österreich herrscht schon seit Wochen große Aufregung um das Buch. Die Menasses sind hier eine berühmte Familie. Der Vater war zu Zeiten größten österreichischen Fußballruhms ein gefeierter Nationalspieler, der Bruder Robert ist ein berühmter Schriftsteller. Und jetzt schreibt also die "Tochter" und "kleine Schwester" einen Familienroman über einen "Vater", der umjubelter österreichischer Nationalspieler war, und über einen feinsinnigen, intellektuellen, berühmten Bruder. Helle Aufregung, "Profil" brachte auf sechs Seiten ein großes Familienalbum der Menasses, die Auslieferung des Buches wurde vorgezogen.
Zum Krieg nach Burma
Erzählt das Buch die Familiengeschichte der Menasses? Diese Frage stellt sich beim Lesen automatisch, auch wenn hier die Familie weniger bekannt ist. Gerade weil das Ich so eine merkwürdige Leerstelle ist. Viele äußere Daten und Fakten stimmen jedenfalls überein. Der jüdische Großvater und die katholische Großmutter, die die Nazi-Zeit in Wien überlebten; der Vater, der lange Jahre bei Pflegeeltern in England wohnte und dabei die deutsche Sprache verlernte; der Onkel, der, sieben Jahre älter als sein kleiner Bruder, unbedingt in die britische Armee wollte, um Österreich von den Nazis zu befreien, abgelehnt wurde und schließlich in Burma kämpfen mußte, noch lange Zeit nachdem der Krieg in Europa beendet war. Ja, das sind die Menasses, und das sind die Menasses natürlich nicht. Denn, auch wenn in der Familie der Autorin ebenso wie in der Romanfamilie der manische Anekdotenwettstreit zu jedem Familienzusammentreffen unbedingt dazugehörte - die entscheidenden Dinge wurden nie besprochen. Daß ihr Vater in England aufwuchs, erfuhr Eva Menasse erst, als sie zwanzig war. Und wenn sie die Großeltern fragte, wie das war, damals, zur Nazi-Zeit, wie sie überlebten, reagierten diese mit Schweigen. Nicht mal ein "Darüber möchte ich nicht reden" oder ein "Dazu sag ich nichts". Sie taten einfach, als hätten sie die Frage nicht gehört. Diese Fragen gab es nicht. Und so gab es auch keine Antworten.
Eva Menasse hat recherchiert, Gesetzeslage, Erlebnisberichte, hat Verwandte interviewt, Geschichten gesammelt, Zeitungen, Gerichtsberichte, und einen Roman geschrieben, der die eigene Familiengeschichte zum Ausgangspunkt hat und eine neue Geschichte ist. Eine andere Geschichte. Die dreißiger Jahre, die Nazi-Zeit, die Erlebnisse des Vaters in England, des Onkels in Burma, das Sterben der Tante in Kanada, das Überleben der Großeltern in Wien, all das ist nur der Anfang der Geschichte, die sich dann weiter, immer weiter schlängelt, ins Nachkriegsösterreich, das sich flugs zum Opferland erklärt, das von den Deutschen brutal besetzt und zum Mitmachen gezwungen worden sei, ein Land, in dem die wenigen zurückkehrenden Juden von ihren Hausmeistern mit einem lockeren "Ach, Sie sind wieder da, ich dacht', die hätten Sie vergast" begrüßt wurden. Bis in die Gegenwart hinein zieht sich dieses Gesellschaftspanorama in Anekdoten. Und manchmal wünscht man sich als Leser einen Thomas Bernhard herbei, der einmal sagte, wann immer er eine Geschichte am Horizont erblicke, schieße er sie ab. Eva Menasse schießt gar nichts ab. Sie wirft Anekdote auf Anekdote in die Luft und läßt sie selig flattern. Das ist manchmal etwas zuviel. Und man fragt sich, was sie umkreisen, die Geschichten.
Ich soll kein Jude sein?
Irgendwann fällt dieser Satz: "Eines Tages erschien mein Bruder mit sensationsheischendem Gesichtsausdruck und verkündete, daß wir gar keine Juden seien." Ein Satz, der alle Sicherheiten raubt. Der Vater erwidert nur: "Was soll das heißen?" Und dann: "Warum bin ich dann emigriert?" Die ganze Lebensgeschichte, all die Opfer, die man brachte, sollen umsonst gewesen sein? Es ist ja lächerlich einfach seit undenklichen Zeiten: Nur wenn die Mutter Jüdin ist, sind auch die Kinder automatisch Juden. Der Vater zählt in diesem Falle nicht. Diese späte Erkenntnis wirft das Familienleben um, den Lebensgeschichten ist der Boden entzogen, und zunächst wird das Anekdotenmäntelchen noch fester um den Körper gezurrt. Erzählen, um sich zu vergewissern. Daß die Wahrheit die war, die man kennt, daß alles logisch, lustig und erstaunlich, aber doch notwendig aufeinanderfolgte, daß nichts umsonst gewesen ist.
Eva Menasse sitzt im mintgrünen Pullover bei Toast und Apfelschorle in einem Wiener Kaffeehaus in Berlin und erzählt in diesem wundersamen, leicht gesungenen, geschwungenen Wiener Dialekt, im Gespräch hört man es kaum, wenn sie aus dem Roman vorliest, wird es stärker. Der ist in dieser Melodie geschrieben. Wenn sie sich selbst im Radio hört, erschrickt sie, sagt sie, vor dem eigenen Dialekt. Sie dachte, sie habe sich schon ganz naturalisiert, hier in Berlin. Das hat sie nicht.
Lange Jahre sei diese Familiengeschichte in ihrem Kopf gewesen, sagt sie. Sie habe es zunächst als kleines Dossier schreiben wollen. Ein paar Seiten, nur für die Familie als Leser. Doch die wahren Geschichten waren eben nicht zu erfahren. Und so mußte es eben darüber hinausgehen und Roman werden. Vor zehn Jahren entstanden die ersten Szenen.
Welche Rolle spielt das Judentum noch für sie? Ja, sie habe einmal darüber nachgedacht, zu konvertieren, aber nicht wirklich. Sie wischt es schnell weg, das Wort. Sie kenne aber viele in ihrer Generation, für die das wieder eine größere Bedeutung erhalte. Und die Geschichten von damals, die könne man erst jetzt richtig erzählen. Die erste Generation schwieg und baute auf, die zweite Generation kämpfte gegen die schweigenden Väter - erst die Enkel könnten die Geschichten wirklich schreiben. Die Enkel können von all dem erzählen.
Eva Menasse hat das getan. Genau zur richtigen Zeit.
VOLKER WEIDERMANN
Eva Menasse: "Vienna". Kiepenheuer und Witsch. 430 Seiten. 16,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»ein Ereignis« Martin Oehlen Kölner Stadt-Anzeiger 20181103