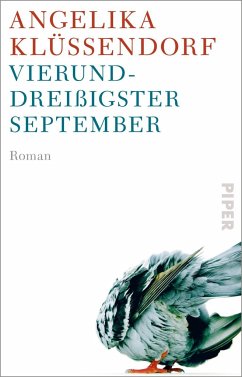»Klüssendorfs Kunst ist die Vermeidung jedweder Künstlichkeit.« DER SPIEGEL
Ein Dorf in Ostdeutschland: Walter, ein zorniger Mann, erschlagen in der Silvesternacht von Hilde, der eigenen Frau. Nur kurz vor seinem Ende war er plötzlich sanft und ihr zugewandt. Dann ein Friedhof: Die Toten studieren die Lebenden. Walter wird zum Chronisten, sieht sich dazu verdammt, die Schicksale im Dorf festzuhalten. Und er fragt nach dem Warum. Was war der Grund für Hildes Tat? Geschah es aus Hass oder aus Barmherzigkeit?
»Vierunddreißigster September« wird zum Dorfroman einer anderen, neuen Art, er kommt den Menschen schmerzend nah. Aus Angelika Klüssendorfs Sprache strahlt eine mitreißende Kraft, sie ist präzise und voll tiefschwarzer Komik. Ein hintersinniges Meisterwerk über eine Zeit der Wut, Melancholie und Zärtlichkeit.
Ein Dorf in Ostdeutschland: Walter, ein zorniger Mann, erschlagen in der Silvesternacht von Hilde, der eigenen Frau. Nur kurz vor seinem Ende war er plötzlich sanft und ihr zugewandt. Dann ein Friedhof: Die Toten studieren die Lebenden. Walter wird zum Chronisten, sieht sich dazu verdammt, die Schicksale im Dorf festzuhalten. Und er fragt nach dem Warum. Was war der Grund für Hildes Tat? Geschah es aus Hass oder aus Barmherzigkeit?
»Vierunddreißigster September« wird zum Dorfroman einer anderen, neuen Art, er kommt den Menschen schmerzend nah. Aus Angelika Klüssendorfs Sprache strahlt eine mitreißende Kraft, sie ist präzise und voll tiefschwarzer Komik. Ein hintersinniges Meisterwerk über eine Zeit der Wut, Melancholie und Zärtlichkeit.
Rezensent Oliver Jungen ist großer Fan von Angelika Klüssendorf, aber mit ihrem neuen Roman kann er beim besten Willen nichts anfangen. Von dem für Klüssendorf typischen psychologischen Scharfsinn keine Spur, meint er. Stattdessen liest der Kritiker zunehmend genervt diese irgendwo im Osten angesiedelte Provinzgeschichte, in der Walter, einst Wendeverlierer und Tyrann, zuletzt dement und milde, von seiner Frau mit der Axt erschlagen wird und das Geschehen von nun aus dem Jenseits kommentiert. Weitere kaputte Lebende und drastisch umgekommene Tote treten auf, nur Subtilität will sich nicht einstellen, seufzt Jungen. Die Handvoll "feingesponnener" Formulierungen kann ihn nicht über den plumpen, teils "zotigen" Humor dieser "öden Dorfgroteske" hinwegtrösten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH