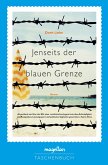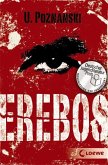Schule und erste Liebe - Lesestoff für schulfreie Tage!
Der erste Schultag. Zwei Wochen vor den Sommerferien ist Beh krank geworden und konnte nicht mit den anderen in den Urlaub fahren. Als das neue Schuljahr anfängt, hat sie alle acht Wochen lang nicht gesehen. Viel ist passiert, ihre Freundinnen haben neue Leute kennengelernt und Geschichten zu erzählen. Beh dagegen war nur zu Hause. Aber eigentlich war da mehr, von dem ihre Freundinnen nichts wissen. Zu Hause liegt eine Postkarte für sie im Briefkasten, in der Stadt gibt es ein Zimmer mit blauen Wänden, da ist ein Hund, ein Mädchen mit Schwimmflügeln und lauter Orte, die Beh bis zum Abend noch fotografieren wird, weil ihnen etwas fehlt. Und als Beh am Ende des Tages ihre Zimmertür schließt, hat sie auch jemand bei ihrem vollen Namen genannt.
Meisterhaft erzählt - dicht und spannungsreich! Nominiert von der Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreises!
Der erste Schultag. Zwei Wochen vor den Sommerferien ist Beh krank geworden und konnte nicht mit den anderen in den Urlaub fahren. Als das neue Schuljahr anfängt, hat sie alle acht Wochen lang nicht gesehen. Viel ist passiert, ihre Freundinnen haben neue Leute kennengelernt und Geschichten zu erzählen. Beh dagegen war nur zu Hause. Aber eigentlich war da mehr, von dem ihre Freundinnen nichts wissen. Zu Hause liegt eine Postkarte für sie im Briefkasten, in der Stadt gibt es ein Zimmer mit blauen Wänden, da ist ein Hund, ein Mädchen mit Schwimmflügeln und lauter Orte, die Beh bis zum Abend noch fotografieren wird, weil ihnen etwas fehlt. Und als Beh am Ende des Tages ihre Zimmertür schließt, hat sie auch jemand bei ihrem vollen Namen genannt.
Meisterhaft erzählt - dicht und spannungsreich! Nominiert von der Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreises!
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Friedtjof Küchemann stößt auf einen Glücksfall mit Tamara Bachs Jugendbuch. Das auszudrücken, was schwer in Worte zu fassen ist, gelingt der Autorin hier laut Rezensent auf hundert Seiten immer wieder. Es geht um den ersten Schultag eines 14 Jahre alten Mädchens nach den großen Ferien und doch um viel mehr, meint Küchemann, der nur staunen kann, wie einfach und zugleich weitreichend diese Geschichte ist und wie die Autorin es versteht, Gefühle und Erwartungen beim Leser hervorzurufen, dass es fast eine Sehnsucht ist. Diese Erwartungen und Leerstellen, mit denen Bach arbeitet, scheinen ihm die Nöte der Pubertät gut abzubilden und was es heißt, wenn der Vater eine Neue hat oder einem jemand eine Postkarte schreibt, an die man sich im Schlaf schmiegt wie an einen Schatz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Freundinnen, die Eltern: Tamara Bach schickt eine Vierzehnjährige durchs Dickicht der Erwartungen. Mit überraschender Eindringlichkeit.
Von Fridtjof Küchemann
Zum Glück muss man nicht gleich schweigen über das, wovon man nicht sprechen kann. Es gibt immer noch die Künste, Bilder, die Bühne, die Musik, wenn es schwer wird mit der Sprache. Zuweilen ist es auch ein Glücksfall, wenn Literatur sich dessen annimmt, was schwer in Worte zu fassen ist. Das Jugendbuch "Vierzehn" von Tamara Bach ist ein solches Glück. Die gerade einmal gut hundert Seiten der Geschichte umfassen einen einzigen Tag, und sie erfassen dabei doch so viel mehr, als an diesem ersten Schultag nach den Sommerferien im Leben des vierzehn Jahre alten Mädchens geschieht, das alle Beh nennen. Alle bis auf einen, und auf den kommt es an.
Anton heißt er, das immerhin erfahren die Leser zum Ende der Geschichte doch noch. Am Samstag hat er die in dieser simplen und zugleich seltsam weitreichenden Geschichte von der Autorin geduzte Hauptfigur geküsst - und ihr eine Karte geschrieben mit nur einem Satz darauf. Den aber erfahren wir Leser einfach nicht. So gerne wir auch wollten. Und das ist gut so. Genauer gesagt: Tamara Bach versteht es, ein Gefühl, eine Erwartung dieses Satzes hervorzurufen, statt seinen Wortlaut wiederzugeben, so dass der Leser regelrecht Sehnsucht nach ihm empfindet. Ein Gefühl, mit dem er der Hauptfigur letztlich so nahekommt, wie es selbst großer Literatur nur selten glückt.
Es geht um Leerstellen in "Vierzehn", und es geht um Erwartungen, dass etwas gesagt oder übergangen wird, beides Eindrücke, die in der Pubertät, wenn die sozialen Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten der Kindheit in Frage stehen, eine nahezu schmerzliche Präsenz gewinnen können.
Die beiden letzten Schulwochen vor den Sommerferien war Beh krank. Aber dass niemand sie seitdem zu Gesicht bekommen hat, dass sie in den Sommerferien nicht verreist war, dass sie immer noch blass und schmal wirkt, hat andere Gründe. Und doch lässt sie ihre Freundinnen glauben, es habe mit ihrer Krankheit zu tun.
Überhaupt, die Freundinnen: Die eine täuscht Übelkeit vor, weil sie im Matheunterricht lieber im Krankenzimmer den neuesten Tratsch austauscht, und lässt Beh spüren, dass sie als Begleitung nur zweite Wahl gewesen ist und sich ihrer trotzdem würdig erweisen sollte. Die andere deutet immer wieder an, viel zu erzählen und noch mehr zu zeigen zu haben. Aber als sich Beh und Jeannette am Spätnachmittag im Schwimmbad treffen und die Freundin ihr den Rettungsschwimmer vorstellt, den sie neuerdings anhimmelt, nutzt der die erste Gelegenheit allein mit Beh, um sich auch an sie heranzumachen. Wovon Jeannette natürlich nichts hören will. Was Beh natürlich vorher wusste. Ohne der Freundin ersparen zu können, was sie erlebt hat, auch wenn sie weiß, dass die ihre Enttäuschung und Wut fürs Erste an ihr auslassen wird.
Manchmal muss eben etwas ausgesprochen werden, worüber es leichter wäre zu schweigen. Und manchmal ist einfach auch nichts mehr zu sagen. Selbst wenn der eigene Vater, als der erste Überraschungsbesuch in seiner neuen Wohnung eine unangenehme Wendung nimmt und Beh nur noch weg will, findet, man könne doch - ja, was eigentlich? Tamara Bach lässt diesen Satz so hilflos in der Luft hängen, wie er ist, als sich das Mädchen am Vater und seinem Abschiedsumarmungsversuch vorbei aus seiner neuen Wohnung drückt. Und wieder weiß der Leser alles, was er wissen muss. Und mehr, als er erfahren hätte, wenn die Autorin den Satz vollendet hätte.
Auch Beh weiß, was sie wissen muss. Sie hat mehr gesehen, als sie sehen wollte: nicht nur die erleichternd schmale provisorische Matratze in dem, was später einmal das Schlafzimmer sein wird. Sondern auch das blau gestrichene Zimmer mit der Borte aus kleinen Segelschiffen. Es ist für den kleinen Halbbruder, der im Januar auf die Welt kommen soll. Von dem Beh durch den zufälligen Blick in dieses Zimmer erst erfährt.
Man könne doch, man sollte doch, manchmal muss man einfach: Tamara Bach hat ein feines Gespür für die Feinheit und Unerbittlichkeit von Erwartungen, und sie hat einen wunderbaren Weg gefunden, es nicht nur auf ihre Hauptfigur zu übertragen, sondern auch gleich auf ihre Leser. Am Abendbrottisch: "Du kaust und schaust deine Mutter an. Und siehst, dass sie was weiß. Und dass du ihr jetzt sagen sollst, was sie schon weiß." Beh hatte weinen müssen, auf der nächsten Bank, nach der Flucht aus der Wohnung ihres Vaters. Jetzt kommt sie in der Geschichte von der anderen Seite in Bedrängnis: "Sie fragt dich, ob er es dir endlich gesagt hat. Was, könntest du jetzt fragen. Das musst du gar nicht. Weil sie weiterfragt, ob er dir erzählt hat, dass er eine Neue hat, mit der er jetzt auch noch ein Kind kriegt. Und sagt dir, wie lange er das schon weiß. Und wie lange er schon vorhatte, euch zu verlassen. Und wie lange das mit der Neuen schon lief. Und wie feige dein Vater ist."
Schließlich lässt die Mutter Beh sitzen. Stellt sich mit Tränen in den Augen ans Fenster, geht auf den Balkon, telefoniert erst mit ihrer besten Freundin und dann mit dem feigen Vater ihrer Tochter. Die sich bei alledem so allein fühlt, wie man sich nur fühlen kann mit vierzehn. Und sich von Antons letztlich hilflosem Anruf trösten lassen kann, davon, dass sie ein bisschen still sind miteinander, zusammen. Bis es wieder geht.
Im Kunstunterricht hat ihnen die Lehrerin eine Fotoserie namens "Schöne Orte" gezeigt: Szenerien, die einmal von Menschen gestaltet, für Menschen gedacht waren und dann offenbar von ihnen aufgegeben wurden. Kurz vor dem Schlafengehen macht Beh selbst ein solches Bild vom ehemaligen Arbeitszimmer ihres Vaters. Dann legt sie sich ins Bett mit der Postkarte, die sie von Anton bekommen hat. Mit ihrem Namen drauf und diesem einen Satz. Den man sich als Leser immer noch denken muss. Und den man sich hoffentlich gar nicht schöner denken kann.
Tamara Bach: "Vierzehn".
Carlsen Verlag, Hamburg 2016. 122 S., geb., 13,99 [Euro]. Ab 14 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Kaum eine andere deutsche Autorin ist mit ihren Romanen so an den Gefühlen junger Menschen" Kirche + Leben 20171022