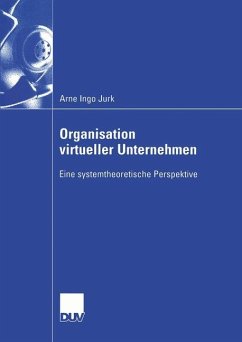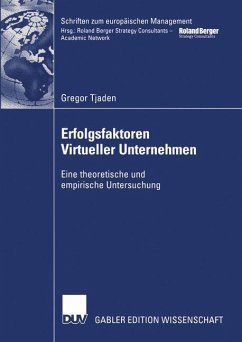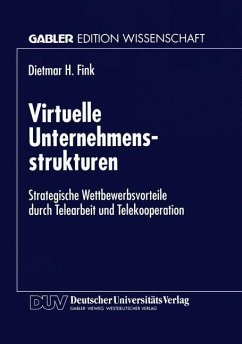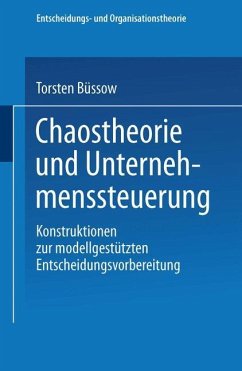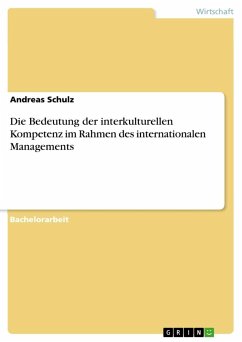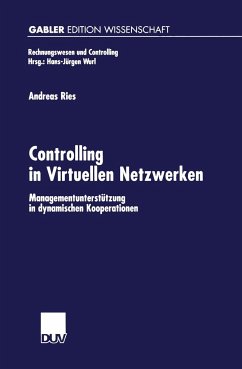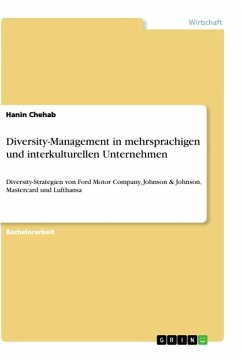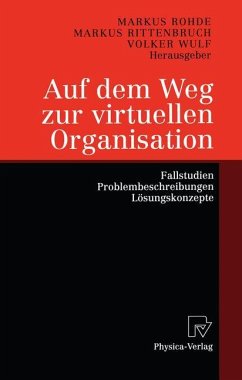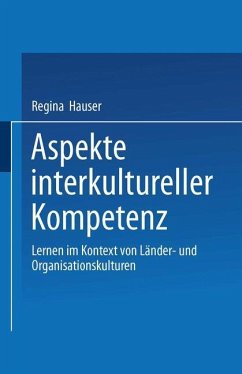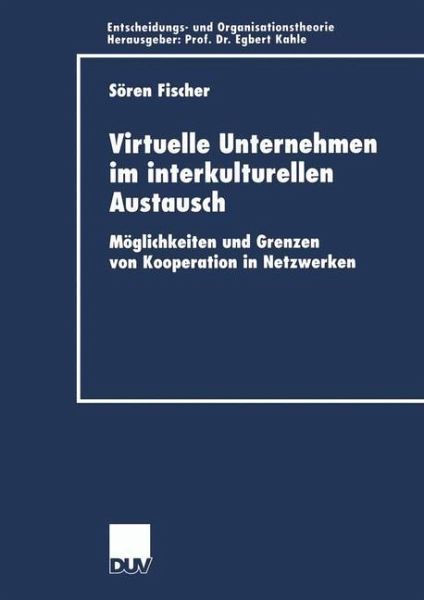
Virtuelle Unternehmen im interkulturellen Austausch
Möglichkeiten und Grenzen von Kooperation in Netzwerken

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der globale Wettbewerb erfordert in zunehmendem Maß Flexibilität sowie Reaktions- und Innovationsfähigkeit; außerdem müssen komplexe Situationen bewältigt werden. Hierfür bietet die interkulturelle Kooperation in Form virtueller Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, allerdings ist diese Organisationsform nicht in allen Bereichen der Kooperation implementierbar.Auf der Basis des system-kybernetischen Ansatzes untersucht Sören Fischer, welchen Nutzen herkömmliche Unternehmen aus einem interkulturellen vertrauensbasierten Austausch ziehen können. Er baut bestehende dichotome Organisa...
Der globale Wettbewerb erfordert in zunehmendem Maß Flexibilität sowie Reaktions- und Innovationsfähigkeit; außerdem müssen komplexe Situationen bewältigt werden. Hierfür bietet die interkulturelle Kooperation in Form virtueller Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, allerdings ist diese Organisationsform nicht in allen Bereichen der Kooperation implementierbar.
Auf der Basis des system-kybernetischen Ansatzes untersucht Sören Fischer, welchen Nutzen herkömmliche Unternehmen aus einem interkulturellen vertrauensbasierten Austausch ziehen können. Er baut bestehende dichotome Organisationsmodelle aus und entwickelt ein trichotomes Erklärungsmodell der Organisation. Ziel ist, das Verständnis für komplexe Organisationszusammenhänge zu erweitern und die eigene Organisation aus einer anderen, breiteren Perspektive zu sehen.
Auf der Basis des system-kybernetischen Ansatzes untersucht Sören Fischer, welchen Nutzen herkömmliche Unternehmen aus einem interkulturellen vertrauensbasierten Austausch ziehen können. Er baut bestehende dichotome Organisationsmodelle aus und entwickelt ein trichotomes Erklärungsmodell der Organisation. Ziel ist, das Verständnis für komplexe Organisationszusammenhänge zu erweitern und die eigene Organisation aus einer anderen, breiteren Perspektive zu sehen.