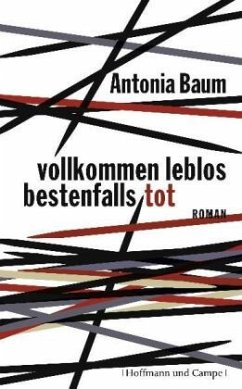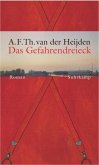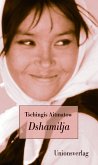Eine junge Frau bricht auf, aus der Provinz in die Stadt, die Hoffnung auf Veränderung ist groß. Aber schnell stellt sie fest, dass sie nicht frei ist: nicht frei vom Unglück ihrer Eltern, nicht frei von der Angst, die sie in Ketten legt, nicht einmal frei in der Liebe, die sich als Farce entpuppt. Wer nur die Geborgenheit eines Gefängnisses kennt, dem erscheint jede Bewegung als Gefahr. Antonia Baums Heldin gibt jener Generation eine Stimme, die in den unendlichen Möglichkeiten des Glücks und der Selbstverwirklichung verloren ist. Ein erstaunliches Debüt, eine tragikomische Suada und ein ebenso emotionaler wie kühl sezierender Blick auf eine kaputte Gesellschaft.

Ein Fanal: Antonia Baums vollkommen lebloses Debüt, in dem eine junge Frau in Berlin nach der Liebe sucht, wird als neue deutsche Literatur verkauft. Was für ein Irrtum!
Sapperlot! Welch eine Verzweiflung muss herrschen auf den deutschen Verlagsfluren, wo offenbar jedes noch so missglückte Debüt mit Handkuss angenommen wird. Sooft sich die Jury des Bachmann-Wettbewerbs schmähen lassen muss: Wenn alle sechs Jury-Mitglieder - mit Ausnahme des Vorschlagenden also - einen Text für grottenschlecht halten, sollte man im Lektorat doch zumindest ins Grübeln geraten, auch zum Schutz der Autorin, die freilich das vernichtende Urteil keineswegs demütig anzunehmen gewillt war, sondern in dieser Zeitung mit einem Lamento über den "schlimmen, menschenentfernten Literaturverwaltungszugang" zurückschlug. Der pure Trotz auch bei Hoffmann und Campe, wo man Antonia Baums pubertär überkandidelten Debütroman "Vollkommen leblos, bestenfalls tot" nun flugs herausbrachte als einen der Toptitel des Herbstes: schöner Einband, schön gedruckt, schönes Papier - welch eine Vergeudung!
Zunächst bekommt der Leser einen expressionistischen Happen hingeworfen, ein Vorsatzblatt, auf dem man - poesiealbumspoetisch entrückt - in den Bauch der Städte hinabsteigt, wo ein Schriftsteller, "der seinen ganzen Unterarm zwischen den Beinen einer Frau versenkte", das Ohr nimmt und "tropfend", als wären wir bei Carl Einstein, hineinsabbert: "Keine Geschichten, nichts Ganzes, nur Bedeutungsloses." Und tatsächlich, das ist eine treffende Vorhersage: Was uns erwartet, ist völlige Substanzlosigkeit, gepaart mit einer ganz erstaunlichen Stil-Unsicherheit, die überspielt wird mittels eines wüst-infantilen Mixes aus Impressionismus, Expressionismus und endlos viel Thomas-Bernhard-Würze (ohne Thomas-Bernhard-Esprit).
Eine wütende, verzweifelte Abrechnung will der Text sein, die Stimme der verlorenen Generation, wobei die Erzählerin ganz am Ende aber doch zu verstehen beginnt, wie die Eltern-Generation in die "Katastrophe", in das "Kopfgefängnis", hineingeraten konnte. Doch nicht ein Krümelchen echte Wut oder Verzweiflung ist in diesem Buch, nur Lieblichkeit und Prätention.
Ihr Leben lang schon leidet die Erzählerin unter ihrem gleichwohl verehrten Vater Götz, einem wahren Götzen, der Frauen verschleißt und einzig aus Egozentrik besteht. Viel zu viele Seiten lang werden häusliche Ehekräche, Männer- und Frauenpsychen sowie Gedankenfluchten rekapituliert, immer schön ins lyrisch Litaneihafte aufgeblasen, aber alle fünf Sätze über eine Stilblüte stolpernd: ein "Raum, der aus allen Richtungen atmete"; "ich richte mich auf und halte einen fest, der weiterzuckt, die Haut wellt sich, wie graue Milch tropft sie ihm über den Kinderschädel". Wenn die gewellte Haut schon tropft, warum um Himmels Willen wie graue Milch? Milch mag ja allerhand sein, aber absolut niemals ist sie grau. Und so geht es hier Schlag auf Schlag. Derart verliebt scheint die Autorin in den Einfall, über den Hitler-Stalin-Pakt gebeugt zu sitzen, während unten im Haus die feindlichen Ehemächte einander bedrohen, dass sie ihn gleich dreimal bringt. Doch das ist erst der Beginn eines sich durch das ganze Buch ziehenden, sinnlosen Nazi-Fimmels, der vielleicht einfach nur blind aus Bernhard mitherauskopiert wurde: "diese nationalsozialistische Popkultur ist es, die dich in Wahrheit anatmet, weswegen diese scheußlichste aller Städte nunmehr als ein nationalsozialistisches Disney-Land zu bezeichnen ist."
Die Erzählerin lebt bald mit dem ihr hyperkreativ verhassten Patrick zusammen. "Patrick, der immerzu feist Aussichherauslächelnde, Patrick, der Nichtssagende", ist irgendwas in den Medien: Anlass genug für eine müde Satire über sensationsgeilen, zynischen Journalismus, die nach ewig langem Anlauf darin gipfelt, dass die Erzählerin eine "Analsex mit Kindern in SS-Uniform"-Bombe einschleust. Patrick gegenüber steht ein Sehnsuchtsmann, der aber so blass bleibt wie alle anderen Figuren: "Seit dem Tag, an dem du Johannes das erste Mal gesehen hast, bist du mit nichts anderem mehr beschäftigt, als ihn zu suchen, genau genommen bist du ja nur noch die Johannes-Suchende." Vielleicht ist dieser überhaupt nur eine Fiktion: "Jo gab es nicht mehr, hat es Jo denn überhaupt gegeben, fragte ich mich." Hinzu kommen noch eine "ekelhafte, ungebundene, unproblematische Schlampe" sowie eine Schwangerschaft, doch mehr als ausgedacht wirkende Befindlichkeitsprosa wird daraus nicht, banales, geschwätziges Phrasengedresche, eine verunglückte Schreibübung, viel Lärm um nichts. Vielleicht sollte man als Autor doch nicht gleich publizierend auf die Welt zustürzen, ohne zunächst etwas erlebt, etwas verloren, etwas verstanden zu haben? Vielleicht sollte ein Verlag einfach keine Romane von unter Vierzigjährigen annehmen?
OLIVER JUNGEN
Antonia Baum: "Vollkommen leblos, bestenfalls tot". Roman.
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2011. 239 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Einen ordentlichen Wutanfall hätte Ijoma Mangold sich gern gefallen lassen (sagt er jedenfalls). Aber Antonia Baums Debüt will er nicht als solchen durchgehen lassen. Wenn die Autorin respektive ihre Erzählerin auf die ganze blasierte Kulturschickeria, auf Heuchelei und Hedonismus schimpft, ihre Eltern, ihren Freund und die ganze "Welt voll Scheiße", dann erscheint ihm ihr Furor höchstens kokett, als ein "Monument bürgerlichen Selbstmitleids", . Allerdings muss Mangold festhalten, dass Baum die Bernhard-Stillage beherrscht, sie kann also was. Gut gefallen hat ihm auch, wie sie vom Relaunch eines Lifestyle-Magazins als einem "Hochamt der Angeberei" erzählt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Dieser Roman ist ein emotionaler Blick auf eine kaputte Gesellschaft.« 20 Minuten, 20.01.2012