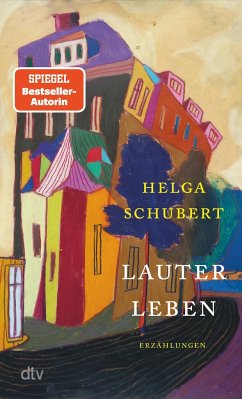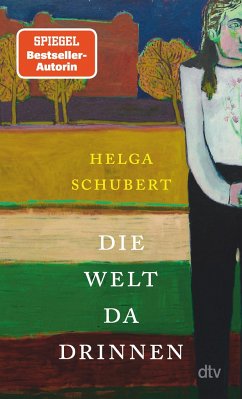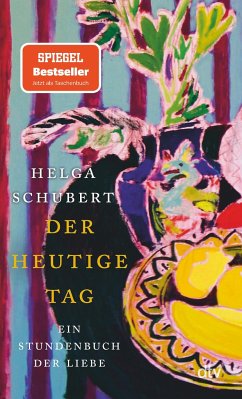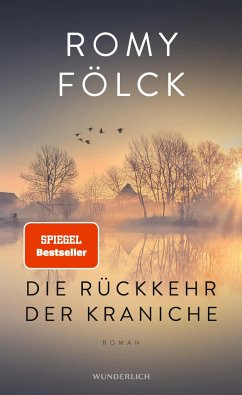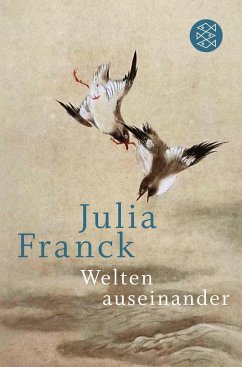Helga Schubert
Broschiertes Buch
Vom Aufstehen
Ein Leben in Geschichten Die Wiederentdeckung einer Jahrhundertautorin
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gebundenen Originalausgabe, Ausstattung einfacher als verglichene Ausgabe.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Ein Jahrhundertleben
Helga Schubert erzählt in kurzen Episoden und klarer, berührender Sprache ein
Jahrhundert deutscher Geschichte - ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit
zugleich. Doch vor allem ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter,
einem Leben voller Widerstände und sich selbst. Nominiert für den Preis der
Leipziger Buchmesse 2021.
Helga Schubert erzählt in kurzen Episoden und klarer, berührender Sprache ein
Jahrhundert deutscher Geschichte - ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit
zugleich. Doch vor allem ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter,
einem Leben voller Widerstände und sich selbst. Nominiert für den Preis der
Leipziger Buchmesse 2021.
Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte ¿Vom Aufstehen¿ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 bei dtv und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2023 erschien ¿Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe¿, 2024 wurde Helga Schubert mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landeskulturpreis MV ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: DTV
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 224
- Erscheinungstermin: 21. September 2022
- Deutsch
- Abmessung: 191mm x 118mm x 21mm
- Gewicht: 203g
- ISBN-13: 9783423148474
- ISBN-10: 3423148470
- Artikelnr.: 63752221
Herstellerkennzeichnung
dtv Verlagsgesellschaft
Tumblingerstraße 21
80337 München
produktsicherheit@dtv.de
Und das schönste Buch des letzten Jahres war der späte Triumph der wunderbaren und viele Jahre unbemerkten Helga Schubert: 'Vom Aufstehen'. Volker Weidermann Die Zeit 20220609
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Rezensent Peter Henning liest Helga Schuberts Lebensroman in Erzählungen mit Spannung und Rührung. 2. Weltkrieg, Flucht und Vertreibung, deutsche Teilung, DDR-Alltag - all das fliegt an Henning vorüber, wenn Schubert sich an ihre Kindheit und Jugend erinnert, an ihre Arbeit als Schriftstellerin und Psychotherapeutin, an eigene Empfindungen und Erlebnisse. Und mittendrin das Porträt der Mutter. Wie die Autorin die schwierige Beziehung zur Mutter thematisiert und daraus eine "Chronik der Vergebung" macht, findet Henning bemerkenswert. Was fiktiv, was erlebt ist in diesem Buch, scheint ihm am Ende gar nicht so wichtig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
"Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus." (Marie von Ebner-Eschenbach)
Die erst kürzlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet Autorin beschreibt in 29 Geschichten aus der Sicht ihres Lebens. Dieser Preis hätte ihr …
Mehr
"Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus." (Marie von Ebner-Eschenbach)
Die erst kürzlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet Autorin beschreibt in 29 Geschichten aus der Sicht ihres Lebens. Dieser Preis hätte ihr schon 1980 zugestanden, doch die DDR Regierung wollte, dass sie ihn ablehnt. Ihre Geschichten erzählt die Autorin hier in der Ich-Form, in knappen kurzen Sätzen und mitunter wiederholen sich einzelne der Begebenheiten. Die Geschichten sind nicht chronologisch angeordnet, sondern ich habe eher den Eindruck, als wenn sie das niedergeschrieben hat, was ihr gerade in den Sinn kam. So schildert sie von der Nachkriegszeit und dem viel zu frühen Tod ihres Vaters, den sie selbst nie kennenlernen durfte, da er im Krieg gefallen ist. Und auch wenn sie ihn nicht kannte, bleibt sein Verlust doch immer ein Trauma für sie. Weil sie nie erfahren wird, ob wenigstens er sie geliebt hätte. Den ihre kaltherzige und lieblose Mutter vertraut lieber der eigenen Mutter ihr Kind an, als sich selbst um sie zu kümmern. Dort jedoch erlebt Helga meist ihre schönsten Zeiten. Besonders, wenn sie in den Ferien zwischen zwei Apfelbäumen in der Hängematte liegt und den Duft von Großmutters frischem Streuselkuchen ihr in die Nase steigt. Zumindest bei ihr fühlt sie Liebe und Geborgenheit, die ihr die eigene Mutter nie geben konnte. Die Mutter dagegen vermittelt ihr bei jeder Gelegenheit, das sie Helga eigentlich erst abtreiben, auf der Flucht zurücklassen und vor den Russen fast vergiften wollte. Was müssen solche Aussagen bei einem Kind für Spuren hinterlassen? Es muss für sie doch jedes Mal wie ein Stich gewesen sein, mitzuerleben, dass die eigene Mutter sie nie haben wollte. Lag diese Ablehnung daran, weil Helga ihrer Schwiegermutter und ihrem Vater so ähnlich war? Selbst mit dem vierten Gebot hadert sie, weil sie ihre Mutter ebenfalls keine Liebe zeigen konnte. Doch eine Theologin kann sie diesbezüglich etwas beruhigen. Und erst als die Mutter stirbt, beginnt sie ihre Leben mit diesem Buch aufzuarbeiten. Bei vielen Geschichten schreibt sie über den Alltag und das Regime der ehemaligen DDR, unter dem sie ebenfalls zu leiden hatte. Sie berichtet von ihrem ehemaligen Nachbarn, der sich erhängt hat, genauso wie über ihren Ehemann, dem Sohn der Enkelin, dem Altwerden und der Pflege, so wie den Vorlieben für gute Gerüche. Da schreibt sie z. B. über ihre Erinnerung an den Duft nach Nelkenseife, das Lavendelsäckchen neben dem Kissen und der Duft ihrer Bettwäsche, der in einem diese Gerüche widerspiegelt. Sie lässt den Leser in ihren Geschichten die Erinnerungen nicht nur fühlen, sehen, schmecken, sondern ebenso riechen. Leider kam ich nicht immer mit ihrem Schreibstil klar, der doch mitunter sehr anspruchsvoll war. Oft musste ich Sätze mehrmals lesen und sogar herausfinden, über wen sie gerade in der Geschichte erzählt. Doch die Emotionen, Tragik, mitunter Humor und insbesondere die Traurigkeit, die sich darin widerspiegelt, die spüre ich auf alle Fälle in ihnen. Und trotzdem sie mit so wenig Mutterliebe gesegnet wurde, habe ich das Gefühl bei ihren Geschichten, das sie mit ihrem Leben glücklich und zufrieden ist. Was sie sicherlich ihrer Großmutter, ihrem Mann, der Familie, dem starken Willen und ihrem Glauben zu verdanken hat. "Vom Aufstehen", einem autobiografischen, sehr persönlichen und intimen Einblick in ihr Leben und über Verletzung und Heilung, dem ich 4 von 5 Sterne gebe.
Weniger
Antworten 16 von 25 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 16 von 25 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Alt ist sie geworden und die Erinnerungen kommen zurück. Die Erinnerung an die Mutter, die ihr zeitlebens zu verstehen gab: Du bist nicht gewollt, Du bist nicht genug-hätte ich Dich doch vergiftet.
So ist sie aufgewachesen in der DDR, dem Land welches sie auch heute noch so liebt, dass …
Mehr
Alt ist sie geworden und die Erinnerungen kommen zurück. Die Erinnerung an die Mutter, die ihr zeitlebens zu verstehen gab: Du bist nicht gewollt, Du bist nicht genug-hätte ich Dich doch vergiftet.
So ist sie aufgewachesen in der DDR, dem Land welches sie auch heute noch so liebt, dass man ihre Gefühle fast körperlich spüren kann. Ein Land in dem 1989 alles anders werden sollte. Die Mauer war weg. Auch wenn sie als Schriftstellerin das Privileg genoss reisen zu dürfen, so wurde sie doch die ganze Zeit überwacht vom Staat.
Einem Staat, in dem man nicht einmal in der Ostsee rausschwimmen durfte, in dem der angebaute Spargel nicht gegessen werden durfte, denn der kam in den Westen.
Helag Schubert beschreibt ihr eigenes Leben ohne Wut und Groll, aber sehr lebendig, berührend und auch kritisch. Jede einzelne Geschichte in diesem Buch ist Wert mehr als einmal gelesen zu werden. Es steckt soviel Weisheit in den kleinen Episoden die Helag Schubert beschreibt. Am meisten berührt hat mich "Mein Winter", "Mein Wald" und ganz besonders " Alt sein", mit all ihrer Schonungslosigkeit.
"Vom Aufstehen" gehört schon jetzt zu meinen Jahreshighlights 2021.
Weniger
Antworten 11 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 11 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein langes Leben zwischen Ost und West !
Das Buch handelt vom Leben der Autorin Helga Schubert. Mittlerweile ist sie 80 Jahre alt und lässt ihr Leben zwischen der damaligen DDR und dem Westen Revue passieren. Sie erlebte den 2. WK als Flüchtlingskind. Sie erzählt mit welchen …
Mehr
Ein langes Leben zwischen Ost und West !
Das Buch handelt vom Leben der Autorin Helga Schubert. Mittlerweile ist sie 80 Jahre alt und lässt ihr Leben zwischen der damaligen DDR und dem Westen Revue passieren. Sie erlebte den 2. WK als Flüchtlingskind. Sie erzählt mit welchen schrecklichen Erlebnisse die Menschen in dieser schlimmen Zeit konfrontiert wurden. Immer wieder erwähnt sie das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter. Bis zu deren Ende konnte sie ihre Mutter nicht lieben. Ich glaube, dass sie zum Schluss ein wenig Verständnis für ihre Mutter aufgebaut, sie zwar nicht geliebt aber akzeptiert hat. Ich fand, dass ihre Mutter oft sehr unfair Helga gegenüber war. Ganz klar, dass sich diese Ungerechtigkeiten bei einem Kind wie ein roter Faden durch das ganze Leben zieht.
Als Schriftstellerin konnte sie öfters in den Westen reisen. Für eine kurze Zeit das Eingesperrt sein im Osten vergessen und ein klein wenig auch den neuen Westen kennenlernen. Die gravierenden Unterschiede der beiden deutschen Staaten waren ihr bekannt, doch sie ging immer wieder in den Osten zurück.
Sie erzählt in einem sehr nüchternem Schreibstil, obwohl sie in ihrem Leben viel schweres erlebt hat. Dies fand ich sehr bemerkenswert. Nicht jeder könnte bei diesen schlimmen Erlebnissen so gelassen schreiben. Ihre Erzählungen wurden in viele kurze Abschnitten eingegliedert. Einmal erzählt sie von der Gegenwart, im nächsten Kapitel schweift sie in die Vergangenheit. Manchmal hätte ich mir Jahresangaben neben den verschiedenen Überschriften gewünscht. Aber es wurde schnell klar in welcher Zeit man sich befand und ich kam mit den verschiedenen Zeitsprüngen sehr gut zurecht.
Ein bemerkenswertes Buch indem die Autorin versucht mit der Vergangenheit abzuschließen. Unter anderem ist die Liebe zu ihrem pflegebedürftigen Mann förmlich zu spüren. Eine etwas andere Biografie und sehr spannend zu lesen. Eine beeindruckende, herzergreifende Geschichte, die mich an vielen Stellen sehr berührt hat und die auch zum Nachdenken anregt.
Weniger
Antworten 8 von 12 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 8 von 12 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein Leben lang
Die Autorin Helga Schubert hat hier ein ganz tolles Buch geschrieben, dass nun nicht umsonst für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. "Vom Aufstehen" ist ihre Geschichte. Doch ist sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich.
Die Sprache ist ruhig und dennoch …
Mehr
Ein Leben lang
Die Autorin Helga Schubert hat hier ein ganz tolles Buch geschrieben, dass nun nicht umsonst für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. "Vom Aufstehen" ist ihre Geschichte. Doch ist sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich.
Die Sprache ist ruhig und dennoch nimmt der Inhalt einen mit. Das Leben und arbeiten in der DDR wird beschrieben und wir sind mittendrin. Ich selbst habe davon nicht mehr viel mitbekommen, doch habe ich das Gefühl es nun durch die Augen von Frau Schubert erlebt zu haben.
Eine ganz große Empfehlung von mir.
Weniger
Antworten 7 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Über das Leben
Drei Themen haben die Geschichten dieses Buches. Das Leben im Krieg, das Leben in der DDR und das Leben im Alter. Alle drei Fäden werden in der Schlusserzählung verbunden, die zu Recht den Bachmannpreis gewonnen. „Es ist da alles im mittlerer Stimmlage und …
Mehr
Über das Leben
Drei Themen haben die Geschichten dieses Buches. Das Leben im Krieg, das Leben in der DDR und das Leben im Alter. Alle drei Fäden werden in der Schlusserzählung verbunden, die zu Recht den Bachmannpreis gewonnen. „Es ist da alles im mittlerer Stimmlage und Stärke gesprochen, mäßig durchaus, durchaus prosaisch, aber das ist der wunderlich übermütigste Prosaism, welchen die Welt gesehen hat“, lässt Thomas Mann in „Lotte in Weimar“ Doktor Riemer über Goethe schwärmen. Er hätte auch über Helga Schubert reden können.
Noch einmal würde ich wegen des ruhigen Tons dieses Buch in der Adventszeit lesen, wenn auch einmal Ostern behandelt wird, weil die Autorin sich beschwert, dass in Kinderbüchern nach dem Abendmahl - ohne vom Leiden Jesu zu berichten – direkt von der Auferstehung geschrieben wird.
Leise fragt sie, wie lange wir wohl noch von Altweibersommer reden, lobt die Pfarrerin, die ihr das Vierte Gebot erklärte und die drei Heldentaten ihrer Mutter, die sie am Leben hielten.
Dennoch fehlt mir in ihrem Werk bis auf „Vom Aufstehen“ das Neue, das Reizvolle, das Unvergessliche. Angesichts des vielen Lobes von mir 4 Sterne, aber dafür noch ein schöner Witz:
Zitat: Treffen sich zwei auf der Straße. Sagt der eine, kennst du schon den neuen Witz, wo die Frau sich aus dem Fenster lehnt und schreit: Hilfe, Hilfe! Ich hab meine Schere verschluckt, und ihr Mann am Fenster auftaucht und sagt, ist nicht so schlimm, nimm meine! - Ne, kenn ich nicht sagt der andere, erzähl mal! (101)
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Helga Schubert ist ein Flüchtlingskind und in der DDR aufgewachsen. Es gibt eine Mutter, die sie zeitlebens nicht geliebt hat, der Vater ist im Krieg geblieben, als sie zwei Jahre alt war. Nur die Ferien bei ihren Großeltern in Mecklenburg waren geliebte Highlights, denn dort begegnete …
Mehr
Helga Schubert ist ein Flüchtlingskind und in der DDR aufgewachsen. Es gibt eine Mutter, die sie zeitlebens nicht geliebt hat, der Vater ist im Krieg geblieben, als sie zwei Jahre alt war. Nur die Ferien bei ihren Großeltern in Mecklenburg waren geliebte Highlights, denn dort begegnete man ihr mit Liebe und Fürsorge.
Frau Schubert nimmt uns mit auf die Reise hinter die Kulissen ihres Lebens. Und bei dem, was man da erblickt, stockt mir teilweise der Atem. Wie kann ein kleiner Mensch aufwachsen mit einer Mutter, die einem den Tod wünscht? Unbegreiflich. Bei allem Verständnis auch für das schwere Leben der Mutter im Hinblick auf den Krieg, auf Vertreibung und Flucht, gibt es nichts, was so etwas verzeihen könnte. Und ganz schlimm finde ich, dass sie dieser Linie bis zu ihrem Tod treu blieb - ich konnte kein Bedauern, keine Entschuldigung finden. Da Frau Schubert sehr neutral schreibt, kann ich nicht genau einschätzen, ob sie ihrer Mutter jemals verziehen hat oder ob sie sich "nur"in eine neutrale Position begeben hat.
Besonders angesprochen hat mich die Geschichte "Wahlverwandtschaft", sie ist toll geschrieben. Durch die gewählte Perspektive erzählt die Autorin sehr distanziert. Ich musste sehr bewusst lesen, um immer mitzukriegen, wer da eigentlich gemeint ist. In meinen Augen passt das absolut zu ihrem Verhältnis ihrer Mutter gegenüber. Die Geschichte hat eine außerordentliche Aussagekraft. Vielleicht schafft man eine so kühle Mutter nur zu überstehen, wenn man innerlichen Abstand schafft. Das hat mich berührt!
Als studierte Psychologin und Schriftstellerin genoß Frau Schubert gewisse Privilegien in der DDR, sie konnte reisen, stand aber immer unter Beobachtung. Wir erfahren in den Geschichten ihr Erleben vor und nach dem Mauerfall.
Am Ende dieses Buches glaube ich verstanden zu haben, was die Autorin mit ihren Geschichten zum Ausdruck bringen will: Es geht ums Verzeihen. Egal, was das Leben für einen bereithält, egal, wie tief die Narben sind, die uns zugefügt wurden - am Ende werden wir verzeihen müssen, um unser Leben selbstbestimmt und frei von selbstzerstörenden Mechanismen leben zu können.
Ich finde es sehr berührend, dass die Autorin viele Stationen ihres Lebens vor uns Lesern ausbreitet. Immer ohne Effekthascherei oder Gefühlsduselei. Die Realität findet man zwischen den Zeilen. Frau Schubert findet wunderbare Worte, die berühren. Es gibt die eine oder andere Geschichte, die mich sehr berührt haben, aber ich habe hier in jeder Geschichte betrachtenswerte Aussagen gefunden. Das ganze Buch eine runde Sache, es wird noch lange in mir nachhallen. Daher von mir die verdiente volle Punktzahl.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In kurzen Episoden schreibt die 80jährige Autorin Helga Schubert von ihrem Leben. Und das Leben umfasste viel. Geboren zu Kriegszeiten, der Vater starb als sie ein Baby war, die Mutter musste flüchten. Dann lange Jahre in der DDR als Schriftstellerin. Auch da war die kurze Form ihre …
Mehr
In kurzen Episoden schreibt die 80jährige Autorin Helga Schubert von ihrem Leben. Und das Leben umfasste viel. Geboren zu Kriegszeiten, der Vater starb als sie ein Baby war, die Mutter musste flüchten. Dann lange Jahre in der DDR als Schriftstellerin. Auch da war die kurze Form ihre favorisierte.
Es geht bei den Episoden zeitlich hin und her. Eben noch Kind, ist sie im nächsten Kapitel schon 80. Eben noch Krieg, dann schon Mauerfall.
Ihre Großmutter bekommt früh ein sehr schönes Kapitel, aber die eigentlich übergroße Figur ist die Mutter, die viele Kapitel deutlich bestimmt.
Es ist ein Buch, das ich sehr schätze, da es die Tragik der vergangenen Zeit verdeutlicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Klappentext:
„Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt …
Mehr
Klappentext:
„Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich. Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich selbst.“
Helga Schuberts Schreibstil ist etwas besonderes und geht ab der ersten Seiten seinen ganz eigenen Weg mit dem Leser. In den kurzen Texten, erleben wir eine Art Biografie und Erzählung und Schubert nimmt uns in ihre ganz persönliche Familiengeschichte mit. Jede Geschichte ist anders genau wie das Leben und hier wird nichts beschönigt. Schubert erlebt alles, was das Leben zu bieten hat. Schubert erzählt aber nicht nur aus dem was vergangen ist, sondern auch aus ihren Gedanken. Jede Geschichte hat ihren eigenen Stil und sie passt ihn den Darstellern an. Wir erleben alle Emotionslagen die es gibt und Schubert schafft es ausnahmslos fesselnd, begeisternd aber auch auf gewisser Weise auf Distanz zu bleiben. Sie zieht uns Leser nicht mit hinein, wir dürfen die Geschichten erfahren, brauchen aber nicht mit ihr mitleiden o.ä.. Es gehört unheimlich viel dazu, so einen Stil zu schaffen und die Leserschaft damit zu begeistern. Für mich war dies eine wirklich wunderbare Leseerfahrung und dieses Buch wird definitiv in die Sparte: „immer wieder lesbar“ einsortiert - 5 von 5 Sterne!
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Vom Aufstehen“ heißt das Buch der Autorin Helga Schubert, das im Verlag dtv erschienen ist. Es enthält nicht nur Geschichten aus ihrem eigenen Leben, sondern für mich ist es auch ein interessantes Stück deutscher Geschichte, erzählt in kurzen Episoden und mit …
Mehr
„Vom Aufstehen“ heißt das Buch der Autorin Helga Schubert, das im Verlag dtv erschienen ist. Es enthält nicht nur Geschichten aus ihrem eigenen Leben, sondern für mich ist es auch ein interessantes Stück deutscher Geschichte, erzählt in kurzen Episoden und mit einem lebendigen, bildhaften Schreibstil.
Für mich ist es das erste Buch, dass das Alltagsleben einer Autorin in der DDR beschreibt, ungeschönt, mit allen Schwierigkeiten, aber auch mit einigen Vorteilen, wie sie zum Beispiel über Reisen einer Schriftstellerin ins Ausland zu berichten weiß.
Zu ganz verschiedenen Themen gibt es kurze Erzählungen, manche davon umfassen nur zwei bis drei Seiten. Helga Schubert bewegt sich in ihren Geschichten zwischen Fiktion und Wahrheit. Jede einzelne ihrer Geschichten ist interessant und beeindruckend, aber sie berühren mich unterschiedlich stark. Ein ganz besonderes Bedürfnis war es der Autorin wohl, über das nicht ganz einfache und selten innige Verhältnis zu ihrer Mutter zu sprechen. Der Wunsch nach einer harmonischen Beziehung ist manchmal nur zwischen den Zeilen zu lesen. Die Unterschiede zwischen Nähe und Distanz sind genial beschrieben, wenn Helga Schubert von "meine Mutter und ihre Tochter" schreibt.
Eine meiner Lieblingsgeschichten ist „ihre“ Ostergeschichte, das, was Helga Schubert darin sieht und die Lehre, die sie daraus zieht: „In dieser einen Woche passiert alles…“:
„Wie schnell sich das Schicksal für einen Menschen ändert, dass man verraten werden kann. Dass es immer unvermuteten Beistand gibt und einen Ausweg.“
Sie hat den Sinn erkannt und will jedes Jahr hoffnungsvoll erinnert werden.“
Das ist für mein Verständnis so genau auf den Punkt gebracht, dass ich davon ganz überwältigt bin und diese Geschichte – wie auch einige andere – bereits mehrmals gelesen habe.
Sehr gern empfehle ich das Buch, das für mich, in kleinen Häppchen genossen, zu einem besonderen Leckerbissen geworden ist.
Weniger
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Im Osten nichts Neues
Mit ihrem Buch «Vom Aufstehen» blättert Helga Schubert in 29 Erzählungen ihre ereignisreiche Lebensgeschichte auf. Mit der titelgebenden, hier als letzte abgedruckten Geschichte gewann sie 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das war für die ziemlich …
Mehr
Im Osten nichts Neues
Mit ihrem Buch «Vom Aufstehen» blättert Helga Schubert in 29 Erzählungen ihre ereignisreiche Lebensgeschichte auf. Mit der titelgebenden, hier als letzte abgedruckten Geschichte gewann sie 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das war für die ziemlich in Vergessenheit geratene Schriftstellerin eine späte Wiederentdeckung. Dieser Band sei eine Hommage an ihre berühmte Kollegin, deren Erzählung «Das dreißigste Jahr» das ‹Aufstehen› thematisiert, erklärte sie in ihrer Klagenfurt-Dankesrede. Morgen werden in Leipzig die diesjährigen Buchpreise verliehen, der vorliegende Erzählband ist unter den nominierten Büchern, - winkt da womöglich eine weitere Auszeichnung?
Die achtzigjährige Autorin hat vieles miterlebt, als Kind die abenteuerliche Flucht vor der anrückenden Roten Armee aus Groß Tychow in Hinterpommern bis nach Greifswald, dann in der DDR das erste Arbeiter- und Bauernparadies auf deutschem Boden, schließlich die Wiedervereinigung und die Jahre danach bis heute. Die Autorin erzählt in einem Mix aus Realem und Fiktivem aus ihrem Leben, wobei sie angemerkt hat, dass sie diesen über viele Jahre hinweg entstandenen Erzählungen wenig Wert beigemessen habe. Nun aber seien sie doch erfolgreich veröffentlicht worden. «Mir ist das unheimlich, und das hängt auch mit meinem Glauben zusammen, dass ich mir sage: Bäume dürfen nicht in den Himmel wachsen. Ich denke dann, wann kommt mein Absturz, also dass die Leute sagen, nun ist es aber mal gut mit der Vergangenheit». Nach dem Mauerfall war es sehr ruhig geworden um die in ihrem Brotberuf als Psychotherapeutin tätige DDR-Schriftstellerin, die sich innerlich mit dem Unrechts-Regime arrangiert hatte. «Ich habe die Regeln des Ostens begriffen und sie beachtet» hat sie dazu angemerkt und ist nicht in den Westen gegangen wie manche ihrer schreibenden Kollegen.
Ihre im Umfang sehr unterschiedlichen Texte sind teils Momentaufnahmen, teils auch längere Rückbesinnungen auf das Erlebte. Gleich die erste Erzählung «Mein idealer Ort» ist ein Beispiel dafür. Sie erinnert sich an das Aufwachen in der Hängematte nach dem Mittagsschlaf bei der Großmutter im Obstgarten, wo sie viele Jahre lang die Sommerferien verbracht hat. Und dann gab es dort immer «Kuchen und Muckefuck», man denkt unwillkürlich an die Madeleines von Marcel Proust. «So konnte ich alle Kälte überleben. Jeden Tag. Bis heute». Ähnlich funktioniert auch die titelgebende, letzte Geschichte in diesem Band, als die Erzählerin morgens wach liegt und sich innerlich auf die Erfordernisse des kommenden Tages vorbereitet, aber auch in kurzen Erinnerungs-Splittern an ihre nicht immer einfache Vita zurückdenkt. Eine dominierende Rolle spielt dabei das problematische Verhältnis zu ihrer Mutter, deren Herzenskälte sie unverkennbar psychisch sehr belastet hat. Die hatte sie jahrelang mit Vorhaltungen gequält und ihr erklärt, es wäre besser gewesen, sie hätte abgetrieben, oder sie auf der Flucht irgendwo allein ausgesetzt, um sie los zu werden, oder sie ganz einfach vergiftet. Dass sie einer solch grausamen Mutter trotzdem vergeben könne, dürfte an ihren religiösen Wurzeln liegen, schließlich habe die Mutter ja ihrem Kind auch vorgesungen.
Neben distanziert beschriebenen Episoden dieser Lebensbilanz finden sich auch emotional berührende. Aber leider auch thematisch unergiebige wie «Eine Wahlverwandtschaft», wo endlos erscheinende Aufzählungen, den Stammbaum hoch und runter, ermüdend wirken mit Sätzen wie: «Und die Tochter meiner Mutter konnte darum auch den Vormittag bei meiner sterbenden Großmutter sein». Der Verwandtschaftsgrad muss reichen, Namen sind Mangelware. Meistens in kurzen Sätzen schon fast lakonisch knapp erzählt, erscheint diese Melange von zu ganz unterschiedlichen Zeiten entstandenen Erzählungen stilistisch äußerst ambivalent. Die inhomogene Zusammenstellung erschwert das Lesen, es fehlt ein innerer Zusammenhang des Erzählten, ein roter Faden, und wirklich Neues wird hier leider auch nicht geboten!
Weniger
Antworten 1 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für