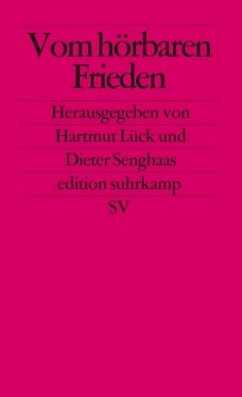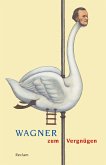»Frieden« ist auch ein Thema der Musik. Es dokumentiert sich in klassischen und zeitgenössischen Kompositionen auf ganz unterschiedliche Weise und reicht von Kriegsdarstellungen in apologetischer bzw. kritischer Absicht bis zu jenen Werken, die das Positive des Friedens klanglich vermitteln wollen. Die musikalische Gestaltung des Friedensthemas ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Der Band zeichnet die entsprechenden Versuche nach, und zwar in ihrer ganzen Vielfalt von hervorragenden Einzelwerken bis zu Komponisten, die ihr gesamtes Lebenswerk dieser Thematik gewidmet haben.

Musikwissenschaftler widmen sich dem "Hörbaren Frieden"
In Ostgrönland trugen bis zum Jahre 1906 die Eskimos ihre Streitigkeiten musikalisch aus: Zwei attackierten sich slange mit von der Rahmentrommel begleiteten Schmähliedern, bis einer aufgab. Das berichtet Max Peter Baumann in seinem Beitrag zum Buch "Vom hörbaren Frieden". Wo sich die Auseinandersetzungen auf klingende Duelle beschränken, ist der Frieden nicht fern. Freilich sind es kaum Friedensklänge, mit denen hier Gewalt vermieden wird. Wilder Gesang und Trommelwirbel gelten weithin nicht als adäquater musikalischer Ausdruck eines Friedenszustands. Aber wie klingt Frieden dann, woran kann man ihn hörend erkennen?
Dieser Frage spüren zweiundzwanzig Autoren, überwiegend Musikwissenschaftler, in dem von Hartmut Lück und Dieter Senghaas herausgegebenen Band nach. Das Thema muß ungemein ergiebig sein, nimmt man die sechshundert Seiten des Wälzers zum Beweis.
Doch die Wahrheit ist, daß viele der Autoren weitschweifig werden, während sie die Hörbarkeit von Frieden verhandeln. Die Musikwissenschaft, der man oft boshaft nachsagt, sie sei sich ihrer Methoden nicht sicher, stellt in diesem Band eben diese Unsicherheit mehrfach unter Beweis. Das mag auch daran liegen, daß das gestellte Thema so viele Gutwillige anzieht, daß seine Substanz womöglich nicht für alle reicht.
Selbstverständlich kann man der Frage nachgehen, auf welch unterschiedliche Weise Komponisten durch die Jahrhunderte die Friedensthematik kompositorisch angegangen haben und welches musikalische Vokabular benutzt wurde, um Frieden klingend erfahrbar zu machen. Man kann sich damit befassen, ob das für Komponisten attraktive Sujet zur Ausbildung einer spezifischen Tonsymbolik geführt hat. Es ließe sich der Charakter politisch motivierter Musik - von Händels Te-Deum-Vertonungen bis zur "engagierten" Musik des zwanzigsten Jahrhunderts - beschreiben. Schließlich mag man sogar fragen, ob bestimmte musikalische Phänomene selbst einen Zustand des Friedens herbeizuführen vermögen - was etwas substantiell anderes wäre als die bloße lautmalerische Darstellung von Frieden durch Ländler, Glockenläuten und Durseligkeit.
Eine Analyse, die eine solch umfangreiche Bearbeitung des Themas, wie sie in diesem Buch geschieht, rechtfertigt, bedarf allerdings des wissenschaftlichen Präzisionswerkzeugs. Denn zunächst einmal ist "Frieden" nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Sujet der Programmmusik - nicht anders als "Liebe", "Sterben", "Glück". Warum der Frieden getrennt vom größeren Komplex programmatisch motivierter Musik behandelt werden soll, müßte erst einmal plausibel gemacht werden.
Wer da einfach aufzählt, wann welcher Komponist welche Werke zum Thema Frieden verfaßt hat, macht es sich zu einfach. Albrecht Dümling listet sorgfältig die Pläne, Entwürfe und ausgeführten Werke Hanns Eislers, Kurt Weills und Paul Dessaus auf und gibt gelegentlich kurze Beschreibungen dieser Antikriegsmusiken. Sein Resümee lautet: "Viele der genannten Werke verdanken ihre Haltbarkeit nicht allein dem Rang der Texte, sondern in gleichem Maße der Originalität und der ästhetischen Bedeutung der Musik." Das kann man nun aber über viele Kompositionen sagen. Auch Jörg Calließ hält nicht viel von der Verwendung des Sezierbestecks: "Frieden hören wir in der Oper eher selten. Wir bekommen aber Geschichten erzählt, in denen Menschen so etwas wie Frieden finden."
Peter Petersen zeigt in seinem Beitrag über Hans Werner Henze, daß es möglich ist, präziser zu arbeiten. Ausgehend von einer kurzen Übersicht über die thematisch relevanten Werke des Komponisten, entwickelt er ein für Henze typisches Begriffsfeld "Frieden", zu dem so unterschiedliche Phänomene wie Freiheit, Schönheit, Fürsorge, Gerechtigkeit, Revolution und Erotik gehören. Anders als die Mehrzahl der hier vertretenen Autoren macht sich Petersen also naheliegende und grundlegende Gedanken darüber, was man überhaupt unter Frieden zu verstehen habe.
Einen originellen Zugang zum Thema findet Peter Schleuning, indem er die Verwicklungen um die Widmung beschreibt, die Beethoven seiner "Eroica" voranstellte. Statt Napoleon rückt in der endgültigen Fassung neben Fürst Lobkowitz "un grand Uomo" zum Widmungsträger auf. Daß der "große Mensch" Prinz Louis Ferdinand von Preußen gewesen sei, nimmt man inzwischen allgemein an. Vom Lager des Franzosen wechselte Beethoven ins Lager des Franzosenfeindes, den er sich aber nicht zu nennen traute. Nahm er hier etwa Rücksicht auf den französisch dominierten Markt? Der großen Friedens- und Freiheitsutopie der "Eroica" steht die von der europäischen Kriegsrealität erzwungene Taktiererei um deren Widmung widersprüchlich zur Seite. "Wie günstig zeigte sich in dieser inhaltlichen Parodie die flexible Funktionalität der wortlosen Instrumentalmusik", resümiert Schleuning und fragt hintersinnig, welches heute "ein dem wechselnden Gehalt der Musik entsprechender Jahrestag sein könnte, das Werk aufzuführen, ob als Dritte Sinfonie, als Sinfonia grande oder eben als Sinfonia eroica."
Schleunings Essay sticht heraus aus der Menge der im Ungefähren verbleibenden Texte. Das Nacherzählen des Notentextes hat jedenfalls noch nie viel gebracht: "In ruhigem Tempo wird das Cis mehrfach artikuliert und charakteristisch gefärbt durch kraftvoll pointiertes Einschwingen; der Ton verebbt nicht, sondern wird lang gezogen und klingt dann aus", schreibt Walter-Wolfgang Sparrer in seinem Beitrag über Isang Yun. Wo der Begriff "Frieden" kaum näher erörtert wird, da gerät auch die Musikwissenschaft ins Schwimmen und flüchtet sich ins rein Beschreibende, andächtig Verehrende oder dunkel Raunende.
MICHAEL GASSMANN
Hartmut Lück, Dieter Senghaas (Hrsg.): "Vom hörbaren Frieden". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 606 S., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Auch aus merkwürdigen Ideen sind schon gute Bücher geworden - hier ist das, bedauert Sebastian Werr, jedoch eher nicht der Fall. Die merkwürdige Idee besteht darin, der Frage nachzugehen, in welcher Weise der Frieden in der Musik hörbar gemacht worden ist bzw. hörbar gemacht werden kann. Eine präzise Antwort scheint man leider nicht zu erhalten, vielmehr konzentrieren sich die meisten der Autoren eher darauf, über "politische Musik" zu schreiben, von Henze bis Nono. Das ist dann immer wieder auch durchaus "lesenswert", räumt der Rezensent ein, das eigentliche Thema, das doch eher nach der Möglichkeit einer musikalischen Friedens-Ästhetik fragte, werde aber verfehlt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH