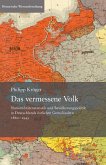Die Politik ist ein schmutziges Geschäft, die Politiker sind langweilig und korrupt, Politik ist immer enttäuschend, immer banal. So alt wie diese Klage ist die Idee von einem Staat, der von Künstlern und der Kunst beherrscht wird - ein Traum von einer besseren Politik, der mit der Instrumentalisierung der Künste in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts endgültig geplatzt ist. Dieser Band zeigt, wie unterschiedlich der Traum vom besseren Staat geträumt wurde - von der Renaissance bis zu Georges Dichterstaat.

Ulrich Raulff versammelt die politischen Utopien von Künstlern
Das Verhältnis von Kunst und Politik war schon immer prekär. Insbesondere in Fällen, in denen Künstler meinten, aus ihrem Künstlerstatus ein politisches Mandat ableiten zu dürfen, kam es häufig zu Reibungen mit der politischen Macht - sei es in Person der Renaissancepäpste oder der bundesrepublikanischen Staatsbeamten, die sich in ihren jeweiligen Herrschaftskonzepten tangiert sahen. Der Traum vom Künstlerstaat ist die Krönung der selbstgewählten Rolle des Künstlers als eines Staatslenkers, ein Traum, der ebenso wie die platonische Utopie der Philosophenkönige zumeist - und man muß wohl sagen: zum Glück - an der Realität scheitert.
Sieben Analysen solcher "ästhetischen und politischen Utopien" hat Ulrich Raulff jetzt in einem wunderbar lesbaren Bändchen ohne allzu forcierten wissenschaftlichen Anspruch versammelt. Von den Dilettantengesängen des Kaisers Nero, die das brennende Rom in eine riesige Bühne für den kaiserlichen Selbstdarsteller verwandelten, bis zu Günter Grass reicht das Themenspektrum dieser Fallstudien. Egon Flaig zeichnet Nero als einen Kaiser, dessen politisches Scheitern in den Augen seiner Untertanen in der unzulässigen Vermischung völlig inkompatibler Sphären begründet war: Seine nach langem Zögern endlich ausgelebte Künstlerexistenz erwies sich als ausgesprochen politisch unkorrekt, brachte sie ihm doch den zweifelhaften Ruf in der stadtrömischen Bevölkerung ein, den Brand in der Stadt aus künstlerischen Gründen selbst gelegt zu haben.
Die Vorstellung vom Künstlerstaat ist ein elitistisches Konstrukt, das aus einer falschverstandenen geistesaristokratischen Haltung erwächst und nur allzuleicht in eine Diktatur des Ästhetischen oder - wie im Falle Georges - des Ästhetizistischen umschlägt. Ausgerechnet Jacob Burckhardt aber zu "einem der bedeutendsten Apologeten der Gewalt" und zum Erfinder des ästhetischen Gewaltmenschen jenseits von Gut und Böse zu machen, wie Ulrich Raulff es in seinem Beitrag zum "Dichter als Führer" tut, heißt, Burckhardts tief verwurzelte Modernitäts- und Staatskritik in dessen Buch "Cultur der Renaissance in Italien" zu verkennen. Zu Recht mag man diesem Buch mit Raulff die "Entgrenzung der literarischen Form zur Epochensignatur" vorwerfen - das macht den Autor aber noch lange nicht zu einem Huldiger des ruchlos Bösen. Denn gerade Burckhardts prägnanter Vergleich von Machiavellis politischem Konzept mit einem "Uhrwerk" kritisiert ja die Schattenseiten einer modernen, funktional-mechanistisch konstruierenden Rationalität bar jeder Humanität.
Wenn der Künstler Anspruch auf Macht und Souveränität erhebt, so ist damit das Potential für handfeste Konflikte mit seinen Auftraggebern gegeben. Ausgehend von der überzeugenden Grundannahme, daß der Künstler dem Herrscher, der ihn im Rahmen eines Patronageverhältnisses beschäftigt, darin überlegen sei, daß er einzigartig und damit unersetzbar ist, rekonstruiert Horst Bredekamp konkrete Auseinandersetzungen Michelangelos mit seinen Auftraggebern. Stets überstrapaziert der autonome Künstler den ihm konzedierten Freiraum autonomer Entfaltung und kultiviert damit ein Pathos der Exterritorialität, das ihn (hierin dem Herrscher gleich) jenseits aller gesetzlichen Zwangsgewalt stellt.
Ein weiteres konfliktreiches Verhältnis zwischen Künstler und Herrscher, das von Anfang an den Keim seines Scheiterns in sich trug, versucht Jens Malte Fischer einmal mehr zu ergründen: die hochaufgeladene Haßliebe zwischen Richard Wagner und Ludwig II. von Bayern. Fischers Fazit in der Beurteilung dieses "hohen Paars" (Raulff) und der spätrevoluzzerhaften Ideen Wagners lautet: "Die Konstellation war von Beginn an verquer: der Jünger als Herrscher, der Meister als Hofkomponist - man stelle sich Friedrich Gundolf als Hessischen Großherzog vor, mit Stefan George als Hofdichter, der vorschlägt, sich an die Spitze eines neuen Rheinbundes zu stellen, sich zum Rhein-Kaiser ausrufen zu lassen und seine Pfalz in Bingen zu wählen."
Ein Patronageverhältnis besonderer Art war Goethes Stellung zum Weimarer Herrscherhaus. Ernst Osterkamp spürt in seinem mit viel Geist formulierten Beitrag dem "Mythos Weimar" nach, den die bildungsbürgerliche Rezeption der Tasso-Leser zu einer "Versöhnungsphantasie von Geist und Macht" zu stilisieren suchte und der sich im Konzept des "Dichterfürsten" personalisierte. Die Metamorphosen dieser Metapher vom "Dichterfürsten" untersucht Eberhard Lämmert in einem brillanten Aufsatz in all ihren sozialen und ideologischen Implikationen von Goethe bis zur spätbundesrepublikanischen Gegenwart. Weimar jedoch war allenfalls ein Musenhof mit bedeutenden Literaten, kein Künstlerstaat. Und Goethe selbst hätte - so Osterkamp - eine gegenseitige Durchdringung von Politik und Kunst strikt abgelehnt. Wäre in Weimar je ein wirklicher Künstlerstaat errichtet worden, so hätte er in minimaler Raumerstreckung ein geistiges Maximalterritorium mit nur zwei Einwohnern umfaßt. Nach Schillers Tod blieb Goethe als einsamer Souverän zurück, denn das Weimarer kulturelle Leben des ausgehenden achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahrhunderts läßt sich laut Osterkamp jenseits des Solitärs Goethe ernüchternd unter "Kulturtourismus in eine Kulturhauptstadt" subsumieren.
Dagegen nimmt sich Friedrich Overbecks römisches Atelier als "intellektuelle und ästhetische Machtzelle" wie ein Künstlerstaat in Reinform aus, wie Michael Thiemann zeigen kann. Gemeinschaftsstiftende Faktoren wie das Tragen der gleichen Haartracht nach dem Vorbild des vergöttlichten Raffael, rituelle Umbenennungen und andere initiatorische Akte sollten die Lukasbrüder unter der sanften Führerschaft ihres charismatischen Meisters Overbeck im "glücklichsten kleinen Freystaat der Welt" einen - und das bis in den Malstil der Meisterschüler hinein. Die Allmachts- und Expansionsphantasien des ungekrönten Hauptes dieser autonomen künstlerstaatlichen Vereinigung beschränkten sich jedoch glücklicherweise auf eine Diktatur der flächendeckenden Freskomalerei in pflaumenweich-frömmlerisch-nazarenischem Stil: "Uebrigens bauen wir täglich neue Luftschlösser von auszumalenden Kirchen, Klöstern und Pallästen - in Deutschland; und kommen wir einmal zurück, so malen wir Euch Alles in Fresco aus!"
In jedem Künstler steckt ein Despot. Künstler müssen egomanisch und von ihrer Mission vollkommen überzeugt sein, denn dies ist die Grundvoraussetzung für die Hervorbringung gelungener Kunstwerke. Allerdings - und dies ist der Lerneffekt des vorliegenden Bandes - sollte sich ihr allumfassender Gestaltungswille besser auf das Reich der Kunst beschränken, sie selber sollten alleinige Herrscher über schöne oder phantastische fiktive Welten bleiben.
CHRISTINE TAUBER.
Ulrich Raulff (Hrsg.): "Vom Künstlerstaat". Ästhetische und politische Utopien. Carl Hanser Verlag, München 2006. 192 S., br., Abb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Erfreulich findet Rezensent Tim B. Müller diesen Band über die traditionsreiche Utopie vom Künstlerstaat, den Ulrich Raulff herausgegeben hat. Die Lektüre des Bandes verdeutlicht für Müller schnell, dass das Modell des Künstlers auf dem Thron besser im Reich der Ideen aufgehoben ist als in der Realität. Zustimmend äußert er sich hier über Rene Königs Einschätzung, die ästhetische Radikalität der Kunst werde im Bereich der Politik notwendig zu Fanatismus und Gewalt. Neben Ulrich Raulffs Aufsatz über Burckhardts Idee vom dem keinen Gesetzen unterworfenen Staatskünstler hebt Müller den Beitrag Egon Flaigs über den Kaiser und Möchtegernkünstler Nero hervor, der um der Kunst willen Rom in Flammen aufgehen ließ. Lobend erwähnt er zudem Horst Bredekamps Blick auf den Ursprung des abendländischen Sonderstatus von Künstlern und Herrschern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"... man kommt beim Lesen aus dem Kichern gar nicht mehr heraus."
Hannes Stein, Die Welt, 11.03.06
"Sieben Analysen solcher "ästhetischen und politischen Utopien" hat Ulrich Raulff jetzt in einem wunderbar lesbaren Bändchen ohne allzu forcierten wissenschaftlichen Anspruch versammelt."
Christine Tauber, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.04.06
Hannes Stein, Die Welt, 11.03.06
"Sieben Analysen solcher "ästhetischen und politischen Utopien" hat Ulrich Raulff jetzt in einem wunderbar lesbaren Bändchen ohne allzu forcierten wissenschaftlichen Anspruch versammelt."
Christine Tauber, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.04.06