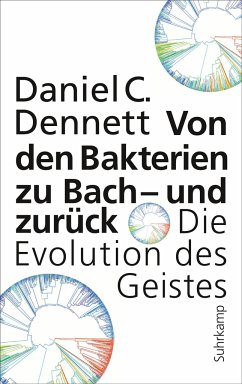Was ist der menschliche Geist und wie ist er überhaupt möglich? Daniel C. Dennett ist der weltweit wohl bedeutendste Fürsprecher von Materialismus, Aufklärung und Wissenschaft. Seit über fünfzig Jahren wirbt und streitet er für seine Ansichten. Mit diesem Buch wagt er noch einmal einen Rundumschlag, eine Meistererzählung von den Ursprüngen des Lebens über die Geistesgrößen der Menschheit wie Johann Sebastian Bach, Marie Curie oder Pablo Picasso bis hin zur Künstlichen Intelligenz.
Dennett zeigt, wie eine vollkommen geistlose genetische und kulturelle Evolution es geschafft hat, zunächst die Einzeller, dann Pflanzen und Tiere sowie schließlich den Geist, die Kultur und das Bewusstsein hervorzubringen. Und er schießt dabei gewohnt scharf gegen Kreationisten, Antidarwinisten und alle anderen, denen ihr dogmatischer Schlummer wichtiger ist als die Wahrheit.
Dennett zeigt, wie eine vollkommen geistlose genetische und kulturelle Evolution es geschafft hat, zunächst die Einzeller, dann Pflanzen und Tiere sowie schließlich den Geist, die Kultur und das Bewusstsein hervorzubringen. Und er schießt dabei gewohnt scharf gegen Kreationisten, Antidarwinisten und alle anderen, denen ihr dogmatischer Schlummer wichtiger ist als die Wahrheit.

Vom Gen zum Mem zum Intellekt: Daniel Dennett knöpft sich Fragen zur Entstehung unseres Bewusstseins vor
"Bewusstsein" ist ein Wort, dessen alltäglichem Gebrauch man kaum die Verwirrungen ansehen kann, die es abseits von ihm hervorbringt. Verliert einer das Bewusstsein, ist er nicht mehr ansprechbar. Tun wir etwas ganz bewusst, dann achten wir darauf und können davon mehr erzählen, als wenn wir es unachtsam tun. Genauso wie dann, wenn wir uns irgendeines Sachverhalts bewusst sind, nämlich ausdrücklich auf ihn achten. Oder auch auf eine eigene Tätigkeit achten, die wir ebenso gut ohne unser explizites Aufmerken ablaufen lassen könnten - sie also bewusst ausüben.
Aber kaum ist der Boden solcher alltäglichen Verwendungen verlassen, zeigt die Rede vom Bewusstsein ihre metaphysischen Mucken. Abgründige Probleme und Rätsel tun sich auf. Wir stellen uns etwa vor, dass jeder von uns sein eigenes inneres Bewusstseinskämmerchen hat, über dessen Inhalt nur er oder sie Bescheid weiß. Nie werden deshalb andere erfahren, wie meine Erfahrung der Farbe Rot sich für mich ausnimmt. Und überhaupt: Dieses innere Anfühlen der Welt und unserer Erfahrung von ihr in unserem Geist, wie soll es durch das wissenschaftliche Aufdröseln neuronaler Verarbeitungsmechanismen jemals erklärt werden? Zeigt nicht das Bewusstsein, unser bewusstes Denken, dieses in unserem Inneren auf rätselhafte Weise angeknipste Licht, die Grenzen jeder Wissenschaft auf? Oder erweist es sogar - wie der Philosoph Thomas Nagel es in einem vielbeachteten Buch konstatierte -, dass die Wissenschaft wesentlich unvollständig ist, weil sich diese Illumination - und damit auch die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft - ihren Erklärungen entzieht?
Auf diese Weise führt das Bewusstsein auf tiefe, "harte" oder unlösbare Probleme. Der gesunde Menschenverstand gerät über sie ins Grübeln, Philosophen debattieren sie mit Verve, Kognitions- und Neurowissenschaftler mischen mit. "Bewusstseinsforschung" ist ein Feld, auf dem nicht zuletzt heftig darüber diskutiert wird, was eigentlich und wie überhaupt zu erforschen sein soll.
Daniel C. Dennett ist auf diese Debatten seit den achtziger Jahren in einigen viel beachteten, auch ins Deutsche übersetzten Büchern eingegangen. Unermüdlich verfocht er die Auffassung, dass das Bewusstsein und unser Geist mitnichten Klapptüren unterhalb normaler wissenschaftlicher Methoden öffnen, sondern deren Gegenstände wie andere auch sind. Heikle Gegenstände, bei denen - die Debatten zeigen es - tiefsitzende Intuitionen und Vorstellungen von unserem Geist verhandelt werden, aber eben doch keine, die die Sonderstellung verdienten, die ihnen gerne eingeräumt wird.
Auch das jüngste Buch des mittlerweile sechsundsiebzigjährigen Professors für Philosophie und Direktors des Center for Cognitive Studies an der Tufts University bei Boston liegt auf dieser Linie. Schließlich gehen die einschlägigen Debatten unter Hirnforschern, Kognitionswissenschaftlern und Philosophen munter fort. Argumente sind deshalb zu schärfen, mit neuen Einsichten und Modellen - etwa der KI-Forschung und der evolutionären Anthropologie - abzugleichen, neue Varianten der Überzeugungsarbeit zu finden. Es geht da immer auch um Lockerungsübungen, das Weglocken von eingefahrenen Vorstellungen und voreiligen Intuitionen über das Funktionieren unseres Geistes, der irgendwie in der Welt und gleichzeitig doch nicht ganz in ihr sein soll.
Dennett ist ein Meister solcher Lockerungsübungen, nie um erhellende Beispiele und anschauliche Erläuterungen für begriffliche und methodische Klärungen verlegen. Er demonstriert es einmal mehr in diesem Buch, in dem er vorführen möchte, wie man sich die Evolution unseres Geistes prinzipiell vorstellen kann. Natürlich nicht in Form einer Theorie, die die konkreten Schritte auf diesem Weg vom Bakterium an klärt - das könnte, weil sich Evolutionspfade nicht einfach noch einmal abspielen lassen, vielleicht tatsächlich nie in Beweismanier gelingen -, sondern durch die Konstruktion eines plausiblen Modellrahmens, in dem sich eine solche schrittweise Entwicklung konzeptualisieren lässt.
Am Anfang steht die rein darwinistische Evolution von organischen Mechanismen und Fähigkeiten. Keine Zielvorstellungen geben ihr einen Entwicklungssinn vor, kein vorab bestimmtes intelligentes Design, sondern ihr Medium ist das beharrliche Austesten von Varianten. Diese Bottum-up-Methode generiert erstaunliche Fähigkeiten von Lebewesen, ohne Beimischung eines Geistes, der sich davon Rechenschaft geben könnte. Dass intelligentes Verhalten vorerst noch gar nichts über Verständnis, also innere Repräsentationen solchen Verhaltens aussagt, das wird Dennett nicht müde vor Augen zu rücken.
Um den graduellen Übergang zu solchen Repräsentationen, die ihren Besitzern immer deutlicher intelligentes Top-down-Design ermöglichen, geht es freilich, wenn die Domäne der darwinistischen Evolution überschritten wird und die Beschleunigungen der kulturellen Evolution ins Spiel kommen. Um sie zu konzeptualisieren, greift Dennett auf die Meme zurück, alles andere als überzeugt von der Kritik, die diese ursprünglich von Richard Dawkins aufgebrachten Einheiten der kulturellen Evolution auf sich gezogen haben. Eine Kritik, die er in fairer Weise referiert und zu entkräften sucht.
Von den in unseren Gehirnen sich replizierenden Memen lässt Dennett nicht, weil sie für ihn die Garanten des Prinzips sind, dass auch für die auf die darwinistische Evolution aufsattelnde kulturelle Evolution gilt: Neue Fähigkeiten gehen zuerst einmal nicht einher mit deren Verständnis durch die von ihnen betroffenen - nach dem Konzept der Meme eigentlich: befallenen - Akteure. Und weil die entscheidenden Meme für unseren hominiden Sonderweg für Dennett die Wörter sind, die der Spracherwerb uns einträgt (wie dieser Erwerb sich genau abspielte, muss dabei offenbleiben), plappern wir erst einmal - und tun das auch später noch öfters - ohne Verständnis.
Im hartnäckigen Rekurs auf die Meme verkörpert sich bei Dennett nicht zuletzt der nüchtern naturalistische Zug seiner Überlegungen. Wobei er nun auch dafür sorgt, dass der Übergang vom darwinistischen Regime der Gene zu einer immer mehr von Memen bestimmten kulturellen Entwicklung - die sich durch ihre eigene Arbeit entdarwinisiert - konzeptuell einigermaßen glatt dargestellt wird: Indem er nämlich bereits die genetische Evolution als Prozess beschreibt, in dem semantische, gar nicht unbedingt kodierte Information verarbeitet wird.
Bleibt aber zu umreißen, wie aus uns dank der Meme die "intelligenten Designer" werden, welche über innere Repräsentationen ihrer Erfahrungen mit der Welt, also über Bewusstsein verfügen. Bei Dennett ist das ein Effekt der vielfältigen, aufeinander aufbauenden Denkwerkzeuge, die sich in unseren Köpfen festsetzen. Eine Computeranalogie kommt ihm zu Hilfe, um zu erläutern, wie sich in seinem Modellrahmen unsere Form der inneren Repräsentation der eigenen Denkwerkzeuge ausnimmt - als eine Benutzerillusion, so wie leicht handhabbare Benutzeroberflächen von PCs oder Apps sich über eine darunter liegende Maschinerie legen, wo die uns verborgene Arbeit verrichtet wird. Wobei gilt, dass diese Illusion keine Täuschung ist, die beiseite zu schieben wäre, denn beim Blick in die neuronale Maschinerie entdeckt man die Repräsentationen naturgemäß nicht.
So resümiert, klingt das nach einem wohl gebahnten Weg. Es ist aber tatsächlich einer, um Dennetts eigene Beschreibung zu zitieren, der "Gebiete durchquert, die kaum ein Philosoph betritt, und Gegenden bereist, die von Philosophen wimmeln, aber selten einen Wissenschaftler sehen". Mit anderen Worten, es ist ein Weg der Art, wie man sie aus früheren Büchern Dennetts schon kennt: keine gerade Schneise durch die Theorielandschaft, sondern ein kreuz und quer führender Weg mit vielen interessanten Aussichten und manchen Abschweifungen. Man muss ihn weder als den einzig möglichen erachten noch Dennett immer beipflichten, um doch zu konzedieren, dass er seine Erklärung der geistlosen Entstehung des Geistes hier auf pointierte und lehrreiche Weise verficht.
HELMUT MAYER
Daniel C. Dennett: "Von den Bakterien zu Bach - und zurück". Die Evolution des Geistes.
Aus dem Englischen von Jan-Erik Strasser. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018.
512 S., Abb., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Das Buch ist eine veritable Tour de Force durch unzählige Wissensgebiete. Dem Autor gelingt es dabei, komplexe Themen so kurzweilig wie verständlich aufzubereiten. Dadurch bietet sein neustes Werk einen gelungenen Einstieg in das kontraintuitive Denken.« Florian Oegerli Neue Zürcher Zeitung 20180914