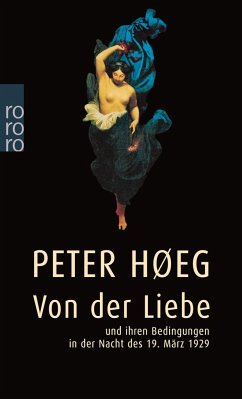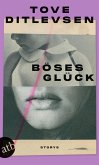Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Metaphysischer Anspruch, nichts dahinter: Peter Høeg redet über die Liebe / Von Christian Geyer
Woher dieses Lähmende, Luftnehmende, das sich bei der Lektüre über die Seele legt? Es ist ein Buch, das man ganz und gar ungern liest. Schon die Vorstellung es demnächst wieder in die Hand nehmen zu sollen, nimmt den Mut und läßt das Bild von feingliedrigen grauen Tierchen aufkommen, die einem übers Gemüt kriechen und sich darin einnisten, um es nach und nach auszusaugen. "Der neue Høeg", wie das Buch des dänischen Schriftstellers Peter Høeg in der Ködersprache des Verlags heißt, ist im Grunde ein alter Fisch, der aber, so muß man vermuten, schon zu riechen anfing, als er noch jung war. Die Originalausgabe erschien bereits 1990 in Kopenhagen und ist jetzt für das deutsche Publikum übersetzt worden. In den Applaus, den Høeg in den letzten Jahren für Bücher wie "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" oder den "Plan von der Abschaffung des Dunkels" bekommen hat, wollte man rückwirkend flugs auch noch sein Frühwerk stellen - und hat damit dem Autor keinen Gefallen getan.
Die sechs Erzählungen, die da unter dem Titel "Von der Liebe und ihren Bedingungen in der Nacht des 19. März 1929" zusammengeschnürt sind, spielen alle in besagter Nacht und wollen alle etwas Grundlegendes zum Thema Liebe in die Welt setzen. Eben das ist das Verhängnis dieses Buches: Man merkt auf jeder Seite, daß es etwas will. Es macht, triefend vor Ambition, die Liebe zu einem Thema, statt sie poetisch einzuspinnen oder ironisch zu brechen. Auf den Stelzen seines Vokabulars stolziert der Autor durch das Gebiet der Liebe, so daß er selbst von überall her sichtbar ist, während die Liebe durchaus unsichtbar bleibt.
Alle sechs Geschichten zeigen die Bedrohungen, denen die Welt des Herzens durch die Welt des Kopfes ausgesetzt ist. Ob es nun die ehrgeizige und emotional abgeschottete Physikerin Charlotte Gabel ist, die sich daran macht, die materiellen Ablagerungen der erotischen Energie vergangener Generationen zu messen, oder der martialisch gezeichnete, aus der Historie des Ersten Weltkriegs gekramte Paul von Lettow-Vorbeck, dessen "furor teutonicus" gegen die aufrichtige Liebe ausgespielt wird, oder der Zerfall der Ehe zwischen einer machtgierigen Frau und einem gefühlskalten Mann: Hegs Geschichten spielen sich auf, als wollten sie das Genre der Liebesliteratur historisch auf neue Füße stellen. Mit prätentiösem Gerede soll noch einmal all das klipp und klar ausgesprochen werden, was Dichter aller Zeiten zart besungen haben.
Das Unglück des Dichters Høeg besteht darin, daß er seiner Dichtkunst nicht zu trauen scheint und daher Schutz sucht im Schoß eines geisteswissenschaftlichen Sprachgebrauchs. Hier glaubt er Objektivität suchen zu müssen, um überzeugend gegen die Objektivitätsmanie der Liebeszerstörer zu schreiben. Damit entspricht er dem merkwürdigen Denkschicksal eines Menschen, der die knickrige Ökonomie der Immanenz entlarven will und dabei keine anderen als immanente Waffen zur Verfügung hat. Was ihm fehlt, ist gerade nicht Objektivität, die vorzuweisen er sich so sehr bemüht (welch einen enzyklopädischen Aufwand betreibt er, um den Leser durch Reihungen gelehrter Fakten aus der Geistesgeschichte zu beeindrucken). Was ihm fehlt, ist die Position eines durch und durch subjektiven Gegenübers, das in der Lage ist, die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen und ihnen dadurch Kontur zu geben. So aber gelangt er über ein mimetisches Anschmiegen an seinen Gegenstand nicht hinaus. Høeg trägt einen gewaltigen metaphysischen Anspruch vor sich her, ohne selbst Metaphysiker zu sein.
Gewiß, hier und da gelingen Bilder, die eine dichterische Kraft aufleuchten lassen - poetische Einsprengsel in einer papiernen Sprachwüste. Es gibt so schöne Stellen wie die Schilderung des eitlen Joseph K. in einem Raum, "wo die Lampen auf dem Tisch sein blasses Gesicht von unten her erleuchteten und seinen Schatten hinter ihm an die Wand warfen, als hätte er einen Zeugen gerufen, der sein Format bestätigen konnte". Oder die Beschreibung der Charlotte Gabel und ihrer Schwestern, an denen die Männer verzweifeln, "denn vor Frauen - sogar wie hier vor kleinen Mädchen -, die sich benehmen, als sei das Dasein nur eine einzige tragende Welle aus Crème Chantilly, werden Männer immer von dem zittrigweichen, wehrlosen, ohnmächtigen Bewußtsein gepackt, Sumpffrösche zu sein".
Aber es gibt vor allem viel Gehemmtes, Verquältes, das der grauen Tierchen wegen am liebsten gar nicht erinnert würde. Wie es so zugeht im Liebesbuch des Peter Høeg, das macht man sich am besten mit der Geschichte vom "Spiegelbild eines jungen Mannes im Gleichgewicht" klar. Mit penetranter autobiographischer Suggestion erzählt Høeg von einem jungen Mann aus Kopenhagen, dessen unerfüllte Liebe ihn auf einen intellektuellen Hügel kraxeln läßt, um von dort aus der Welt von seinen ersten Einblicken ins Gebirge des Geistes zu künden. Das ganze ist so peinlich, wie es sich anhört und spiegelt leider auch den Gestus der anderen fünf Geschichten. "Nicht nur, wenn wir sprechen, wiederholen wir uns selbst und andere. Auch unsere Handlungen sind Klischees." So banal der Satz aus der "Spiegelbild"-Erzählung auch ist, er beschreibt doch ziemlich genau den Zustand der Erzählung selbst.
Bedrückend die pädagogische Selbstgefälligkeit, mit der der Autor versucht, den gemeinen Psychojargon in einen dichterischen Rang zu hieven: "Jetzt, wo ich alles hinter mir gelassen habe, kann ich zugeben, daß mein Durst nach Wirklichkeit mit meinem Verhältnis zu Frauen zu tun hatte." Hätte Høeg selbst doch nur Ernst gemacht mit der Konsequenz, die sein junger Mann nahelegt: "Die Sprache ist arm. Ich habe keine Lust, noch weiter von diesem Anblick zu sprechen." Statt dessen spricht er weiter, weil er gemerkt hat: "Der Spiegel hatte meine Erwartung hinsichtlich der Wahrheit registriert." Und immer wieder sucht er sich auf das hohe Roß der Wissenschaft zu schwingen, um größer zu sprechen, als es seinem wortscheuen Thema gut tut. Auf beinahe jeder Seite sieht man Hoeg, wie er sich wohlgefällig beim Absondern von gelehrten Trivialitäten zusieht. Das kostet Anmut. Wenn er nicht als Psychologe auftritt, spricht er als Literaturwissenschaftler ("Wenn Poe über Spiegel schrieb . . . Soll mir das gleiche passieren?"), als Philosoph ("In dem Augenblick, in dem wir die Welt betrachten, beginnt sie sich zu verändern") oder als wirrer Systemtheoretiker ("Ich sah die großen Systemkonstrukteure und ihr Werk").
Wie ist das nun aber, wenn die Liebe den Verstand raubt, wenn sie einem die Sprache verschlägt? Dann läuft, wie am Ende der Erzählung, das theoretische Bewußtsein noch einmal zur Höchstform auf: "Ich schreibe dies mit einem zunehmenden fatalen Selbstgefühl. Ich werde aufgeblasen, ich steige empor. Ich kann den Bleistift nicht halten. Meine Liebe zu ihr ist einzigartig, sie ist enorm. Wo ist die Frau? Hilfe!" Hilfe.
Peter Høeg: "Von der Liebe und ihren Bedingungen in der Nacht des 19. März 1929". Erzählungen. Aus dem Dänischen übersetzt von Monika Wesemann. Hanser Verlag, München 1996. 232 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main