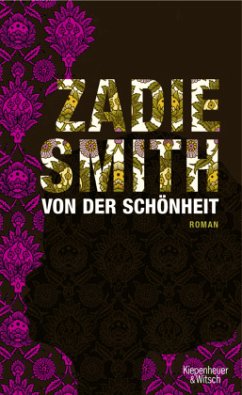Zadie Smiths Weltbestseller über alles, was schön ist Wenn Howard Belsey etwas hasst, dann sind es neokonservative Menschen. Ein Paradebeispiel ist für ihn sein Erzfeind Monty Kipps, wie er Universitätsprofessor und Rembrandt-Experte. Als sich Howards Sohn Jerome in Montys attraktive Tochter verliebt, fühlt sich Howard genötigt einzuschreiten erotische, intellektuelle und familiäre Verwicklungen und Katastrophen nehmen ihren Lauf.
Howard Belsey, ein weißer Engländer, der an einem College in der Nähe von Boston Kunstgeschichte lehrt, ist mit der schwarzen Kiki verheiratet. Zu seinem Missfallen nimmt ihr Sohn Jerome einen Ferienjob bei seinem Erzfeind Monty Kipps in London an und verliebt sich unsterblich in dessen Tochter Victoria. Unerträglich werden die Dinge für Howard, als Monty Kipps auch noch an seine Uni berufen wird, seine Frau Kiki ihn wegen seiner Affäre mit einer Kollegin links liegen lässt und sich zudem mit Mrs. Kipps anfreundet, seine Tochter ihm in der Uni den Rang abläuft und Jerome sich zunehmend zum Christentum hingezogen fühlt.
Komisch, rasant, mit liebenswerten und unvergesslichen Charakteren erzählt Zadie Smith in ihrem dritten Roman die Geschichte einer mehr als turbulenten Familie zwischen England und Amerika, schwarz und weiß, Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus. Der Roman, wie Zähne zeigen ein Welterfolg, ist ein gelungenes Spiel, das den englischen Gesellschaftsroman, namentlich E.M. Fosters Howards End, gekonnt in die heutige Zeit transferiert.
Das Hörbuch erscheint parallel im Hörverlag
Howard Belsey, ein weißer Engländer, der an einem College in der Nähe von Boston Kunstgeschichte lehrt, ist mit der schwarzen Kiki verheiratet. Zu seinem Missfallen nimmt ihr Sohn Jerome einen Ferienjob bei seinem Erzfeind Monty Kipps in London an und verliebt sich unsterblich in dessen Tochter Victoria. Unerträglich werden die Dinge für Howard, als Monty Kipps auch noch an seine Uni berufen wird, seine Frau Kiki ihn wegen seiner Affäre mit einer Kollegin links liegen lässt und sich zudem mit Mrs. Kipps anfreundet, seine Tochter ihm in der Uni den Rang abläuft und Jerome sich zunehmend zum Christentum hingezogen fühlt.
Komisch, rasant, mit liebenswerten und unvergesslichen Charakteren erzählt Zadie Smith in ihrem dritten Roman die Geschichte einer mehr als turbulenten Familie zwischen England und Amerika, schwarz und weiß, Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus. Der Roman, wie Zähne zeigen ein Welterfolg, ist ein gelungenes Spiel, das den englischen Gesellschaftsroman, namentlich E.M. Fosters Howards End, gekonnt in die heutige Zeit transferiert.
Das Hörbuch erscheint parallel im Hörverlag

Gegensätze ziehen sich nicht an: Mit "Von der Schönheit" hat Zadie Smith einen rasanten Roman über verfeindete Familien, Schwarz und Weiß, England und Amerika geschrieben
Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe enden kann, so wird jemand gerade diese Art wählen. Die junge englische Autorin Zadie Smith hat auf der Erfahrungsmaxime von Murphys Gesetz einen Roman aufgebaut, und das Wundersame ist, daß darin zwar für die fünf Mitglieder der Familie Belsey vieles schiefgeht, aber das Buch, das von ihren Enttäuschungen und Entgleisungen erzählt, überaus gelungen ist.
"Von der Schönheit" ist eine tiefe Verneigung mit anschließender koketter Pirouette vor E. M. Forster, dessen "Wiedersehen in Howards End" Zadie Smith mal ausdrücklich, mal spielerisch aufgreift, vom ersten Satz über die Konstellation zweier grundverschiedener Familien bis hin zu den Liebschaften, Bündnissen und Verwicklungen, die sie untereinander eingehen. Der spätviktorianische Bloomsburyianer Forster, dem es in seinem Werk, ob in Romanen wie "A Passage to India" (1924) oder in seinen literaturkritischen Schriften, stets darum zu tun war, Hürden zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Einstellung und Lebensart zu überwinden, ist Zadie Smiths Hausgott; doch vor der altmodisch-umständlichen Diktion, die diesen bisweilen befiel, bewahrt sie ihr erzählerisches Temperament. Ganz wie er jedoch schwelgt sie in der Unberechenbarkeit der Charaktere, die sie durch die panoramatisch angelegte Erzählweise aus deren unterschiedlichen Perspektiven noch zu unterstreichen weiß.
Die Belseys nämlich sind eine liberale, unkonventionelle, bunte Familie. Howard, weißer Metzgerssohn aus England, und seine afroamerikanische Frau Kiki sind geprägt vom Geist der späten sechziger Jahre, als Kiki für Malcolm X schwärmte und für Howard Rebellion nicht nur eine intellektuelle, sondern eine lebenspraktische Herausforderung war. Inzwischen haben sie sich im akademisch gehobenen Mittelklassemilieu des angesehenen Ostküstencolleges Wellington behaglich eingerichtet. Kiki, aufgrund ihres resoluten Naturells und ihrer im Laufe der Jahre auf 250 Pfund angeschwollenen Statur geerdet, arbeitet in der Krankenhausverwaltung; Howard, linkisch, dogmatisch und weltfremd, brütet neben seiner Lehrtätigkeit bereits Jahre über einem poststrukturalistischen Werk zu Rembrandt, einem Künstler, den er eigentlich nicht ausstehen kann. Die Kinder Jerome, Zora und Levi hat das Paar zur Selbständigkeit erzogen, indem es ihnen einfach keine andere Wahl ließ, als zu sehen, wo sie bleiben: erst das Individuum, dann die Gemeinschaft.
Das von Howard leidenschaftlich verabscheute Gegenmodell zu seiner eigenen, lässig multikulturellen amerikanischen Familie sind die durch und durch schwarzen, britischen, christlich gesinnten und konservativ denkenden Kipps, genauer: Sir Monty Kipps, sein Erzrivale. Das Unheil - und damit der Roman - nimmt seinen Lauf, als sich der rührend ernsthafte Jerome bei einem England-Aufenthalt erst in das behütete Familienleben der Kipps und dann in die kesse Tochter Victoria verliebt. Kaum daß er, seiner Unschuld und seiner romantischen Illusionen beraubt, zurück nach Hause kommt, tragen seine Eltern nach dreißig Jahren die erste Ehekrise aus, sorgt seine angriffslustige Schwester Zora auf dem College für Furore, wo sie ausgerechnet das Creative-Writing-Seminar der Ex-Geliebten ihres Vaters belegt hat, und der Bruder Levi hat sich aus seiner hormonellen Gleichgültigkeit gerissen, um mit fragwürdigen Mitteln für die aus Haiti stammenden Landsleute Rechte einzufordern. Das alles wäre für Howard, der seine akademischen Lehrsätze längst auch daheim in Form von oberlehrerhafter Geschmacksdominanz auslebt, womöglich noch zu bewältigen, hätte er als neuen Kollegen in Wellington nicht ausgerechnet soeben seinen Widersacher Monty Kipps vor die Nase gesetzt bekommen. Sir Monty, der im maßgeschneiderten Dreiteiler seine Wurzeln aus Trinidad ganz unakademisch glamourös verbrämt und der von Affirmative Action sowenig hält wie von Howards kunsthistorischen Ansichten, bringt diesen zur Weißglut. Als die an der Untreue ihres Mannes leidende Kiki sich auch noch mit Montys Frau Carlene anfreundet, Howard selbst sich wider Instinkt und besseres Wissen von Montys rabiat-erotischer Tochter Victoria (jawohl, dieselbe, die schon seinen Sohn Jerome auf dem Gewissen hat) verführen läßt und die Familien Belsey und Kipps schließlich über eine Erbschaft und einen jungen Rap-Poeten namens Carl erneut heftig aneinandergeraten, ganz zu schweigen von einem universitären Showdown zwischen Howard und Monty - da ist das Ende, das Howard nehmen wird, vorgezeichnet.
Gekonnt mischt Zadie Smith Milieus, Hautfarben und Ansichten, bedient sich der Genre des Campus-, des Gesellschafts- und des Bildungsromans; doch was herauskommt, ist nicht nur ein süffiges, zeitgemäß multikulturelles Potpourri der sich reibenden und mischenden Kulturen, sondern ein ebenso anspruchsvoller, geistreicher wie über weiteste Strecken unterhaltsamer Roman, der eine breite Brücke schlägt zwischen Großbritannien und Amerika. Das betrifft die Schilderungen der jeweiligen Mentalitäten und Lebensweisen ebenso wie den unterschiedlich nuancierten Gebrauch des Englischen. Stilistisch äußert sich das in einer rasanten Mischung aus E. M. Forster und Philip Roth, David Lodge und Tom Wolfe. Hat Zadie Smith von den Engländern die Lust an der weitschweifigen Beschreibung (die indes gelegentlich mit ihr durchgeht), so hat ihr der amerikanische Kanon die nötige Unverfrorenheit dafür mitgegeben und den wachen Sinn für die Empfindlichkeiten von Minderheiten und Außenseitern.
Wenn sie die Ehe von Howard und Kiki aus der Sicht einer Bekannten schildert, klingt das dann so: "Es war eine Verbindung, die sich kaum definieren ließ. Er war ein Büchermensch, sie nicht. Sie nannte eine Rose eine Rose. Er nannte es eine Ansammlung kultureller und biologischer Konstrukte im Spannungsfeld zwischen Natur und Kunst." Doch der humorvolle Ton kann und soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß die kleinen, zum Mitleiden einladenden Dramen, die die Belseys erleben, tief empfunden und als solche bei aller Komik nie läppisch sind. Und obschon sich im Deutschen nicht die ganze Vielfalt der Tonfälle und Slangs des englischen Originals nachahmen läßt, bietet Marcus Ingendaays Übersetzung doch einen prallen Eindruck von dem, was Zadie Smith kann.
Nach dem gefeierten Debüt "Zähne zeigen" (2001) und dem weniger geglückten Nachfolger "Der Autogrammhändler" (2003) beweist sie mit "Von der Schönheit", daß sie keineswegs ein One-Hit-Wonder ist. Zadie Smith, dessen darf man nach Lektüre dieses Romans freudig gewiß sein, ist gekommen, um zu bleiben.
Zadie Smith: "Von der Schönheit". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Marcus Ingendaay. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006. 517 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Im Zentrum dieses in der kleinen Universitätsstadt Wellington angesiedelten Gesellschaftsromans, so der überaus beglückte Rezensent Tobias Heyl, steht der Konflikt zwischen zwei Familien, oder genauer gesagt zwischen zwei Familienoberhäuptern: dem innovativen und erfolglosen weißen Kunsthistoriker Howard Belsey und seinem konservativen und erfolgreichen schwarzen Kontrahenten Monty Kipps. Sehr gefallen hat dem Rezensenten, wie Zadie Smith diese Fronten aufweicht (etwa indem sie die Kinder aus aus der elterlichen Linie ausscheren lässt), wie sie zeigt, dass Fronten nie klar verlaufen. Mit viel Liebe zum Detail beschreibe Smith den "Planeten Wellington" als ein großes Chaos und vollziehe dieses Chaos erzählerisch nach, anstatt eine (auch von ihren Figuren herbeigesehnte) Ordnung anzustreben. Wie Smith selbst angebe, sei dieser Roman auch vor dem Hintergrund von E.M. Forsters "Wiedersehen in Howard's End" zu lesen: Auch ihren Figuren gehe es deutlich besser, je mehr sie sich von der Hoffnung auf bessere Zeiten verabschieden. Sie üben sich in Desillusionierung und werden dadurch nicht nur leichter, sondern wie der Rezensent findet, auch schöner.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Von der Schönheit ist ein grandioses Buch. Klug, geistreich, niveauvoll und von hellem Witz. [...] Bald werden Zadie Smiths Bücher ein Teil des Kanons sein.« Daniel Kehlmann Die Zeit
»Sehr selten: Ein Roman, der so ergreifend ist wie unterhaltsam, so provokativ wie menschlich.« Michiko Kakutani The New York Times