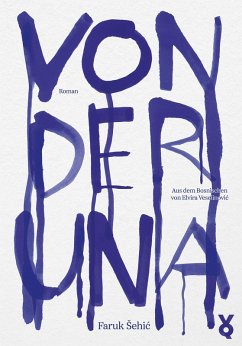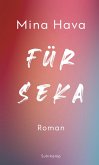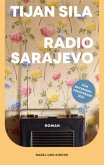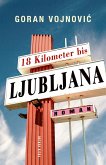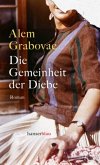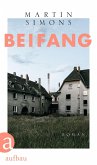"Von der Una" ist der gelungene Versuch, ein persönliches Kriegstrauma schreibend zu verarbeiten und zu überwinden. Wir folgen der Hauptfigur des Romans durch drei Zeitabschnitte: Kindheit und Jugend in Jugoslawien vor dem Krieg, Fronterfahrung während des Bosnienkrieges und schließlich der Versuch, nach dem Konflikt ein normales Leben zu führen. In seiner sehr lyrischen, meditativen Prosa rekonstruiert Faruk Sehic das Leben eines Mannes, der sowohl Kriegsveteran als auch Dichter ist. Der Historiker lehrt uns, was geschehen ist, der Dichter, was für gewaltige emotionale Spuren es hinterlassen hat und der Ästhet, wie man auch noch aus den schmerzhaftesten Erinnerungen den maximalen Genuss ziehen kann. Parallel zu dieser Geschichte nehmen die Passagen des Buches über die Stadt am Fluss Una mythische, traumgleiche und phantastische Dimensionen an.
"Es ist unmöglich, einen einprägsamen Satz zu schreiben über einen Roman, der auf jeder Seite aus einprägsamsten Sätzen besteht. Nur so viel: Dies ist ein Buch über den Krieg und den Soldaten und den Fisch und den Fluss und den Schmerz und - wie alle Bücher - dieses aber in besonders gelungener Manier - über das Überleben. Es singt und rumort und fließt und kämpft und liebt."
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
So hat Rezensentin Sieglinde Geisel noch nie über Kriegstraumata gelesen, wie im Buch von Faruk Sehić. Der Autor schreibt aus eigener Erfahrung: mit einunzwanzig Jahren wird er in Bosnien Soldat, erklimmt die Karriereleiter und zieht in den Krieg gegen Serbien. Doch Sehić' Prosa autobiografisch zu nennen wird ihr nicht ganz gerecht, meint Geisel, seine "ab- und ausschweifende" Prosa gehe über das persönliche Erleben hinaus und kulminiere in außergewöhnlichen Formulierungen, die "kein anderer" schreiben könne. Sehić beginnt bei seiner Kindheit, deren Verbundenheit mit der Natur er als eine Art paradiesischen Zustand beschreibe, der im krassen Gegensatz zum späteren Geschehen stehe. Wirklich chronologisch sind die Erinnerungen aber nicht, vielmehr springt der Autor häufig zwischen Orten, Zeiten und Schauplätzen so Geisel. Der Krieg wird hier stilistisch unterschiedlich verhandelt, einmal in seiner ganzen physischen Gewalt und Bedrohlichkeit, auf der anderen Seite aber auch nüchtern stilisiert durch Natur-Metaphern: "es regnete Mörsergranaten wie Blumensträuße". Auch vor seiner eigenen Brutalität macht der Ich-Erzähler nicht halt, wenn er beschreibt, wie das Töten im Krieg zur Leichtigkeit wird, gleichzeitig gibt es gedankliche Abgründe, um die er einen "weiten Bogen" macht, wie zum Beispiel den sogenannten "Folter-Hangar". Die Rezensentin scheint von diesem Buch jedenfalls nachhaltig beeindruckt zu sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH