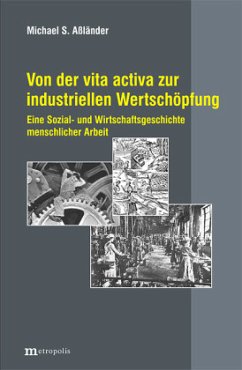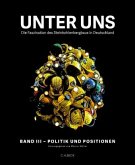Kein anderer Lebensbereich bestimmt die soziale Selbstwahrnehmung des modernen abendländischen Menschen mehr als seine berufliche Arbeit. Neben der Ermöglichung materieller und sozialer Chancen bildet sie neben der Familie den wohl wichtigsten Bereich sozialer Identifikation. Der Zwang zur Arbeit scheint dem modernen Menschen inhärent. Nicht materielle Not zwingt ihn zur Arbeit, sondern er selbst ist es, der sich die "rastlose Berufsarbeit" als Zwang auferlegt. Mindestens seit Beginn der Neuzeit wird individuelle Berufsarbeit Ausdruck und Ausweis erfolgreicher Lebensführung. Allerdings hat sich im Zeitablauf die Vorstellung dessen, was innerhalb je unterschiedlicher Kulturen und sozialer Kontexte als Arbeit verstanden wurde, erheblich gewandelt. Das moderne Arbeitsverständnis ist nicht das Ergebnis einer technischen und ökonomischen Entwicklung, sondern umgekehrt schuf erst ein geändertes soziales und kulturelles Verständnis von Arbeit Raum für neue Techniken und Arbeitsformen und erlaubte so die Entwicklung der neuzeitlichen Ökonomie. Die historische Rekonstruktion des Arbeitsbegriffes von der Antike bis zur Gegenwart macht deutlich, dass das Arbeitsverständnis vor allem durch den kulturellen Kontext der jeweiligen Gesellschaften geprägt ist. Ähnlich, wie sich die gesellschaftlichen Vorstellungen bezüglich Familie oder Moral im Zeitablauf und in Abhängigkeit des je spezifischen kulturellen Kontextes verändern, unterliegt auch der Begriff der Arbeit einem ähnlichen Bedeutungswandel. Aßländer geht es in seiner Habilitationsschrift darum, Arbeit als "Kulturbegriff" zu entwickeln. Diese Sichtweise von Arbeit als Kulturbegriff bedeutet dabei auch den Verzicht auf eine klare Definition von Arbeit. Zwar lassen sich die verschiedenen Vorstellungen dessen, was als Arbeit innerhalb verschiedener Gesellschaften angesehen wird, analysieren und innerhalb gewisser Grenzen miteinander vergleichen. Dies kann aber stets nur hinsichtlich einzelner Aspekte geschehen, so etwa hinsichtlich der sozialen Funktion von Arbeit oder deren rechtlichen Status innerhalb der jeweiligen Gesellschaften.

Eine Ideengeschichte der menschlichen Arbeit
Es ist ein ambitioniertes Ziel, das Michael Aßländer verfolgt: Er will die kulturelle Bedeutung der Arbeit in der europäischen Geschichte seit der Antike darstellen und die aktuelle Diskussion um die Zukunft der Arbeit historisch unterfüttern. Sein Buch, vom Internationalen Hochschulinstitut in Zittau für das Fachgebiet "Sozialwissenschaften insbesondere Wirtschaftsethik" als Habilitationsschrift angenommen, beginnt mit dem antiken Ideal des Bürgers, dem es entsprach, daß dieser von den Erträgen seiner agrarischen Güter lebte und selbst von Handarbeit verschont blieb. Arbeit war zwar für niedere Sozialgruppen vorgesehen, sie sollte aber kein Mittel des sozialen Aufstiegs sein. Mittelalterliche Autoren dann orientierten sich zunächst stark an der biblischen Überlieferung von der Arbeit als Fluch Gottes nach der Vertreibung aus dem Paradies. Jedoch wandelten sich die Auffassungen und distanzierten sich auch zunehmend vom antiken Erbe, wie Aßländer darlegt. Im Rahmen der Ständegesellschaft, in der jeder Bürger seine Aufgabe wahrzunehmen hatte, wurde die Arbeit zur Pflicht aller zum Wohle Gottes und der Menschheit. Auch wenn die konkreten Inhalte der Arbeit noch sozial gestuft waren, kamen doch auch die Höhergestellten zumindest theoretisch nicht mehr um sie herum. Arbeit wurde aufgewertet und verlor das "Stigma der moralischen Minderwertigkeit".
In den dynamischen Handelsstädten entstand aber schon im Spätmittelalter ein weltliches Verständnis von Arbeit, das in ihr die Grundlage politischer Rechte und des individuellen Aufstiegs sah. Arbeit rückte somit zunehmend ins Zentrum der Gesellschaft. Damit wurde auch schon das vom frühneuzeitlichen Bürgertum wesentlich erweiterte Fundament der heutigen Arbeits- und Erwerbsmentalität gelegt. Für den modernen Bürger ist der Gelderwerb durch Arbeit ein zentraler Lebensinhalt, dem er die meisten anderen Lebensbereiche unterordnet oder unterordnen muß. Die Vertreter der klassischen Ökonomie sahen in ihr die Quelle gesellschaftlichen und individuellen Reichtums sowie einen "Urtrieb menschlichen Strebens". Das Recht auf Eigentum und soziale Teilhabe leitete sich nun von der individuellen Arbeit ab, nicht von Herkunft und Stand. Umgekehrt wurden Arbeitsunlust und mangelnder Leistungswille zu schweren sozialen und sogar psychischen Defekten erklärt - mit der entsprechenden Ausgrenzung der Betroffenen. Daher wurde das Einschärfen von Fleiß und Sparsamkeit seit der Aufklärung zu den Grundprinzipien bürgerlicher Erziehung, die auch dem Proletariat den Weg zur Selbsthilfe weisen sollten. Die Vertreter der klassischen Ökonomie sahen im Arbeitsaufwand übrigens zunächst das entscheidende Kriterium für den Wert der hergestellten Produkte.
Vom bürgerlichen Arbeitsverständnis springt der Verfasser direkt in das zwanzigste Jahrhundert. In diesem galt weiterhin die bürgerliche Norm, derzufolge permanente Erwerbsarbeit der biographische Normalfall ist. Zugleich kam es im Namen des technisch-ökonomischen Fortschritts zum massenhaften Abbau von Arbeitsplätzen. Dieser Widerspruch bestimmt bis heute die Debatte. Das Ende der klassischen Arbeitsgesellschaft schafft Verunsicherung und Veränderungsdruck - sowohl auf politischer als auch individueller Ebene. Die Schlüssel zur Bewältigung dieser Umbrüche sind, so schreibt Aßländer, weniger neue Modelle der Arbeit als vielmehr Neudefinitionen der sozialen Bedeutung von Arbeit. Wie die im einzelnen aussehen könnten, läßt er allerdings offen.
Dem Autor gelingt es in diesem anregenden Buch, mit einem allerdings recht groben Pinsel die Ideengeschichte der Arbeit nachzuzeichnen und die Einbeziehung der kulturellen Dimension in die Diskussion um die Zukunft der Arbeit einzufordern. Eine "Sozial- und Wirtschaftsgeschichte" der Arbeit hat Aßländer jedoch nicht geschrieben - von der Realgeschichte der Arbeit schweigt er trotz eines guten Forschungsstands. Zudem fällt er wiederholt weit hinter diesen zurück, da ihn die Weite seines Zeitraums zur Schematisierung nötigt. So argumentiert er mit längst überholten Konzepten wie denen einer statischen antiken Wirtschaft oder einer geschlossenen Hauswirtschaft und stellt "Bedarfs- und Überflußwirtschaft" gegeneinander, als ob es sich um historisch klar abgrenzbare Systeme handelte. Auch verengt er die Darstellung auf die männliche Erwerbsarbeit; die Arbeit der Frauen gerät aus dem Blick. Schließlich durchzieht das Buch die Überzeugung, daß die Geschichte im wesentlichen in den Köpfen weniger Meisterdenker gemacht wird und die Zukunft in konzeptionellen Neuansätzen liegt. Ein Blick in die Realität der Werkstätten, Fabriken, Büros und vor allem Haushalte hätte ein etwas differenzierteres Bild ermöglicht.
HARTMUT BERGHOFF.
Michael Aßländer: Von der vita activa zur industriellen Wertschöpfung. Eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte menschlicher Arbeit. Metropolis-Verlag, Marburg 2005. 450 Seiten, 36,80 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main