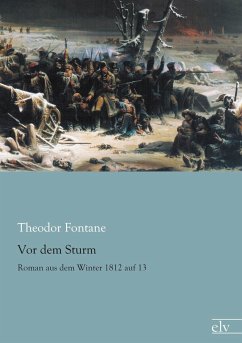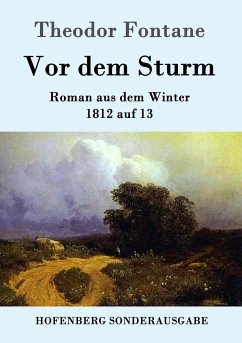Theodor Fontane kam die Idee zu diesem historischen Roman bereits Anfang der 1860er Jahre während der Arbeiten an den "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", veröffentlichte ihn jedoch erst 1878. Das Oderbruch zum Jahresende 1812: Napoleons Truppen strömen nach dem vernichtenden Rückmarsch aus Russland ins Land. Von patriotischer Begeisterung beflügelt stellen Adelige und Bürger Landsturmkompanien auf, um die Franzosen anzugreifen; Initiator ist Berndt von Vitzewitz, der sich damit ausdrücklich gegen den preußischen König stellt. Sein Sohn Lewin steht der Begeisterung jedoch kritisch gegenüber. Die Zeit zwischen Weihnachten und Sylvester 1812 verbringt die Familie mit Freunden, deren Gespräche von Hoffnungen und Ängsten sowie der Ahnung erfüllt sind, dass umfassende gesellschaftliche Veränderungen bevorstehen.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno