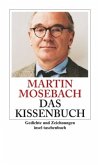Von der verführerischen Macht des Zweifelns
Für Sophia, journalistischer Nachwuchsstar auf dem absteigenden Ast, eröffnet sich die große Chance: Sie soll für das Staatliche Symphonieorchester München das Programmheft konzipieren und die Musiker bei ihren Proben und Konzertreisen begleiten. Als aus der Affäre mit dem gefeierten Cellisten Daniel eine Liebesbeziehung wird und sie in seine Wohnung im Glockenbachviertel zieht, braucht sie ein neues Projekt. Sie beginnt, einen Roman zu schreiben, und stößt auf beunruhigende Informationen aus Daniels Vergangenheit. Wenn sie ihrem Verdacht folgt, gefährdet sie ihre Beziehung. Wie wahrhaftig muss Liebe sein?
»Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung in der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft.« DIE ZEIT
Für Sophia, journalistischer Nachwuchsstar auf dem absteigenden Ast, eröffnet sich die große Chance: Sie soll für das Staatliche Symphonieorchester München das Programmheft konzipieren und die Musiker bei ihren Proben und Konzertreisen begleiten. Als aus der Affäre mit dem gefeierten Cellisten Daniel eine Liebesbeziehung wird und sie in seine Wohnung im Glockenbachviertel zieht, braucht sie ein neues Projekt. Sie beginnt, einen Roman zu schreiben, und stößt auf beunruhigende Informationen aus Daniels Vergangenheit. Wenn sie ihrem Verdacht folgt, gefährdet sie ihre Beziehung. Wie wahrhaftig muss Liebe sein?
»Georg M. Oswald ist eine Ausnahmeerscheinung in der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft.« DIE ZEIT

Hermeneutik des Verdachts: Georg M. Oswald aktualisiert den Liebesroman des achtzehnten Jahrhunderts im München der neunziger Jahre.
Da hat ein Mann vor langer Zeit eine Untat begangen (oder ist sie ihm nur unterlaufen?), für die er nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Jetzt wünscht sich dieser Täter aber nichts mehr, als "jemanden zu finden, der einen vorbehaltlos liebt". Vorbehaltlose Liebe heißt, sie muss auch die Untat einschließen. Im Wissen um die Tat zu lieben wäre der ultimative Liebesbeweis. Was also tun? Ein Geständnis ablegen? Riskant. Man weiß nie, wie der andere im Schockmoment reagiert, wenn er plötzlich dem demaskierten Bösen ins Angesicht sieht. Und könnte man selbst überhaupt garantieren, dass man sich überhaupt dem so lange Verdrängten zu stellen vermag? Also anders: Ohne sich das offen einzugestehen, bereitet dieser Täter systematisch seine Enttarnung vor: Er bezieht eine Wohnung direkt am einstigen Tatort. Er bewahrt in einem Album aussagekräftige Fotos auf, beginnt einen Roman über seine Tat zu schreiben und versteckt seine Erzählversuche im eigenen Keller. (Der Mann heißt übrigens Daniel Keller.) Er besorgt sich den einstigen Polizeibericht und lagert ihn in einem Safe ein, als dessen Code er ausgerechnet das Datum seiner Untat verwendet.
Dann beginnt er eine Beziehung mit einer Journalistin, die schon aus beruflichen Gründen gar nicht anders kann, als der von Ricoeur so genannten "Hermeneutik des Verdachts" zu folgen. Heißt: Sophia Winter - von kühler Weisheitsliebe soll ihr Name wohl zeugen - beginnt herumzuschnüffeln. Damit sie sich dabei nicht gestört fühlt, verreist Daniel Keller vorsichtshalber für ein paar Tage. Mehr lässt sich kaum tun, um die Enthüllungsunwahrscheinlichkeit zu minimieren. Ist damit das Liebes- und Lebensdilemma gelöst? Zum Profil dieses Liebestäters gehört, dass er nur in Form der Übertragungsliebe fühlen kann. Nach Freud tritt sie ein, wenn Patienten sich in ihre Therapeuten verlieben. Diese Liebe hat nichts mit den Eigenschaften des Therapeuten zu tun, sondern bedingt sich nur aus der Struktur der Therapie. So ergeht es auch Daniel Keller, für den die erhoffte Erlösung nur in der Katastrophe enden kann. Würde "Vorleben" diese Täterpsychologie erzählerisch entfalten, könnte er ein atemberaubender psychologischer Liebeskrimi sein. Doch Georg M. Oswald legt diese Erzählung nur an, um dann lieber einem anderen Erzählstrang zu folgen.
Ein Roman, der das psychologische Potential seiner Figur einfach wegschenkt, lässt sich verkraften, wenn er stattdessen eine noch bessere Geschichte erzählt. Hierfür vertraut "Vorleben" vollständig auf die Perspektive seiner weiblichen Hauptfigur. Und das erweist sich als Kardinalfehler. Denn so bleibt nur, von Sophia Winters Recherche zu erzählen. Weil Daniel Keller aber so akribische Vorarbeit geleistet hat, bleibt diese denkbar spannungsfrei. Sophia hat nichts weiter zu tun, als ein paarmal durch Daniels Dachwohnung im Münchner Glockenbachviertel zu streifen, einmal in seinen Keller zu gehen, ein Fotoalbum aufzuschlagen und ein wenig im Netz zu recherchieren. Schon der Besuch des kultumwitterten Platten- und Buchladens "Optimal" ist erzähllogisch überflüssig.
Was sie herausfindet, kommt über ein wenig Neunziger-Jahre-Folklore aus dem Glockenbachviertel kaum hinaus. Damit ihre detektivische Minimalleistung die Erzählung vor Fadheit nicht gänzlich zum Stillstand bringt, verschränkt sie diese mit einer kritischen Revision ihrer Liebesgeschichte. Diese Beziehung wiederum droht in Klischees zu ersticken. Als Cellist bei den Philharmonikern erscheint Daniel Keller nämlich als der nach außen tätige, beruflich erfolgreiche Mann. Ein solches weltreisendes Manns-Glanzstück muss sich im Privaten als angemessen lebenslädiert erweisen: Geschieden ist er, mit einer Tochter, die er gern so viel häufiger sehen würde, wenn nur der Weltruhm und die bösen Anwälte der Ex nicht wären.
Sophia hingegen, zehn Jahre jünger als Daniel, schlägt sich als freie Journalistin durch. Mäandernd, planlos, kommt sie von Berlin für einen zeitlich befristeten Schreibjob nach München. Um den Auftrag endgültig zu bekommen, muss sie erwartungsgemäß noch bei Daniel vorsprechen. Prompt landet sie den beruflichen Treffer und am selben Tag noch in Daniel Kellers Bett. Kurz darauf zieht sie bei ihm ein. Und jetzt soll man also gespannt zuschauen, wie Verdacht auf Keller trifft? Wobei Sophia angeblich die Sorge zerfrisst, ob sie denn gegenüber einem Geliebten überhaupt einen Verdacht schöpfen dürfe. "Und wenn man es tut, warum folgt man diesem Verdacht?" Die Lage ist ernst: "Fragen wie diese stellten sich Sophia Winter seit einigen Tagen."
Die Emanzipationsgeschichte kommt so altbacken daher, als hätte Rousseau sein Erziehungspüppchen "Sophie" gestern in Papier gegossen. Zumal das Problem, das Sophia umtreibt, seinerseits so alt ist wie die Erfindung der individualisierten Liebe selbst: Individuelle Liebeswahl bedeutet stets, dass man nur das Offensichtliche des Gegenübers wahrnehmen kann, man aber von den äußerlichen Zeichen auf den Charakter schließen muss. Unausweichlich hat man nur die Gegenwart vor Augen, während Vergangenheit und Zukunft im Dunkeln liegen. Mit Sophia verhandelt der Roman also das Trivialitäten-Abc des Authentizitäts- und Liebesdiskurses. Der erste deutschsprachige Roman, der dieses Liebesdilemma anhand seiner weiblichen Protagonistin durchgespielt hat, liegt lange zurück: Sophie von La Roches "Geschichte des Fräuleins von Sternheim" aus dem Jahr 1771. Ersetze Schloss durch Penthouse, Adel durch Bildungsbürger-Elite, Privatbibliothek durch Buchladen - sonst hat Georg Oswald Sternheims Liebesreflexion nicht hinzuzufügen.
Sind diese Einwände unangemessen? Weil "Vorleben" einfach nur ein unterhaltsamer Liebeskrimi sein will, durch den man lektüreleicht hindurchschwebt? Warum nur handelt es sich dann auch noch um einen Thesenroman? Getragen wird er von der Frage: "Was halten wir für wahr? Sind es nicht oft die Dinge, die wir oft genug wiederholen?" Wie ernst der Roman diese Wiederholungsfrage meint, zeigt sich unter anderem an seinem engstmaschigen Netz rhetorischer Wiederholungsfiguren. So überzeugt Daniel seine Sophia etwa von dem vermeintlich in ihr schlummernden Romantalent: ",Schreib etwas!', wiederholte er, eins ums andere Mal. ,Ich könnte über dich schreiben.' ,Über mich? Ich bin nicht wichtig', sagte er mit der wuchtigen Selbstsicherheit von jemandem, der nie anders als wichtig genommen worden war. ,Schreibe. Schreibe etwas. Du bist Schriftstellerin. Du tust so, als wärst du keine. Als wärst du gar nichts. Aber genau das bist du: eine Schriftstellerin. Schreibe!'" Wenn sich Sophia von diesem Wiederholungsgewimmel nicht überreden lässt (überzeugt ist sie zu keiner Zeit), dann wissen wir auch nicht, was wir noch von der steilen Wiederholungsthese dieses Romans halten sollten. Georg M. Oswalds Stilmittel-Beharrlichkeit mag ästhetisch konsequent sein, aber jede Lesestudie weiß, wie es Rezipienten ergeht, die Redundanzen durchwandern müssen, anstatt relevante, neue Informationen zu erhalten.
CHRISTIAN METZ.
Georg M. Oswald: "Vorleben". Roman.
Piper Verlag, München 2020. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Christian Metz hat jede Menge zu kritisieren an Georg M. Oswalds neuem Roman. Die Geschichte um einen skrupulösen Verbrecher, der einen Roman über seine Tat zu schreiben vorhat, und eine Journalistin, die ihm auf den Fersen ist, beginnt der Autor laut Rezensent damit, dass er das Potenzial eines "Liebeskrimis" wegschenkt und sich ganz auf die Recherche der weiblichen Hauptfigur fokussiert. Was daraus folgt ist laut Metz allzu spannungsfrei und klischeebeladen. Und was darin an Emanzipationsgeschichte schlummert, handelt der Autor altbacken wie vor 250 Jahren ab, meint der Rezensent. Zweifel, ob seine Kritik für einen leichten Unterhaltungsroman nicht zu scharf ist, wischt Metz beiseite: Dafür haut Oswald dem Leser einfach zu viele Thesen und "rhetorische Wiederholungsfiguren" um die Ohren, findet er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt.« Süddeutsche Zeitung 20200316