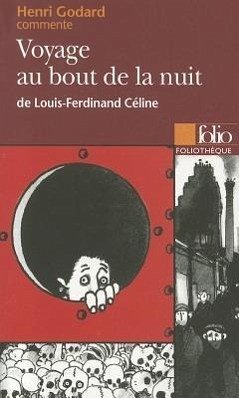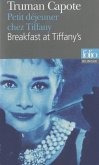Produktdetails
- Foliotheque
- Verlag: Gallimard Education
- Erscheinungstermin: April 1991
- Französisch
- Abmessung: 178mm x 109mm x 13mm
- Gewicht: 181g
- ISBN-13: 9782070383504
- ISBN-10: 2070383504
- Artikelnr.: 25203052
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Libri GmbH
- Europaallee 1
- 36244 Bad Hersfeld
- 06621 890

In der Céline-Biographie Henri Godards geht es mehr um Texte als um Skandale
Louis-Ferdinand Céline starb im Sommer 1961 in seinem Haus in Meudon, einem Vorort von Paris. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst einige Tage später. Witwe und Freunde wollten das Begräbnis nicht von Nachrufen überschatten lassen, die unvermeidlich auch auf Célines wüste Pamphlete der späten dreißiger Jahre und der Okkupationszeit kommen mussten. Prozess und Verurteilung, die ihm diese mit rabiatem Antisemitismus durchsetzten Veröffentlichungen eingetragen hatten, lagen damals kaum mehr als zehn Jahre zurück. Das Skandalon war gegenwärtig, auch durch Célines nach dem Krieg erschienene Bücher. Doch die literarische Konsekration, um die Céline zuletzt hartnäckig gerungen hatte, stand unmittelbar bevor: Nur wenige Monate nach seinem Tod erschien der erste Band einer Werkausgabe in der Bibliothèque de la Pléiade. Frankreich hatte einen modernen Klassiker, der gleichzeitig zum politisch Unberührbaren geworden war.
Deshalb überraschte es auch nicht, dass das Jahr, in das sein fünfzigster Todestag fällt, mit einem kleinen Skandal begann. Céline figurierte in dem vom französischen Kulturministerium herausgegebenen "Receuil des célébrations nationales" für 2011. Serge Klarsfeld wollte das nicht durchgehen lassen und forderte als Präsident der Organisation "Söhne und Töchter deportierter französischer Juden", dass das offizielle Frankreich über den Todestag des Antisemiten, der zum Mord angestachelt habe und den sein "Talent" nicht entschuldige, stillschweigend hinweggehe. So kam es denn auch, trotz Protesten aus intellektuellen Kreisen.
Was freilich nichts daran änderte, dass Céline in den folgenden Monaten überall in Frankreich zu finden war: ob auf den Büchertischen oder in den Sondernummern der Literaturzeitschriften. Vor allem aber erschien pünktlich zum Todestag Henri Godards lange erwartete Céline-Biographie. Sie ist glücklicherweise nicht das überbordende Opus geworden, wie es über Jahrzehnte mit ihren Autoren befassten Spezialisten manchmal unterläuft. So viel Material Godard an der Hand hat, so souverän weiß er mit ihm umzugehen. Die Linien seiner Darstellung bleiben klar, und auch wenn die Lektüre der Werke nicht im Vordergrund stehen kann, werden die Verknüpfungen zu Célines Texten auf überzeugende Weise vorgenommen.
Kaum zu vermeiden ist, dass man diese Biographie mit der Absicht liest, das Skandalon Céline besser zu verstehen, vor allem den Absturz also in die hemmungslosen Tiraden, die 1937 mit den berüchtigten "Bagatelles pour un massacre" einsetzten. Da war Céline bereits dreiundvierzig, und eigentlich deutete selbst in den Jahren davor, wie Godard zeigt, kaum etwas auf diese radikale Wendung hin. Zumindest, wenn man antijüdische Äußerungen und Ressentiments als Indikator nimmt.
Wichtiger scheint dagegen, dass der Autor Céline, der 1932 mit der "Reise ans Ende der Nacht" fulminant auf die literarische Bühne trat, von Beginn an seine Außenseiterstellung betonte. Nicht zum Betrieb zu gehören, vor allem nicht auf bequemen bürgerlichen Wegen zum Schreiben gekommen zu sein, so wenig wie zum Arztberuf, das strich er hervor. Für ihn, der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammte, habe es die Schule des Lebens gegeben statt des Lycée. Zuerst kam die Notwendigkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen, dann erst durch Krieg und kaum vorhersehbare Umstände die Möglichkeit des Medizinstudiums.
Seine Verfahren, das wohlgesetzte Französisch zu unterlaufen und mit unsauberen Anteilen des mündlichen Gebrauchs aufzumischen, war mit dem Image des Außenseiters eng verknüpft. Beim zweiten Buch ließ sich auf diesen Status nicht mehr ohne weiteres setzen. Die Reaktionen auf "Mort à crédit", in denen er den Ton noch verschärft hatte, fielen tatsächlich kühl aus. Céline war tief enttäuscht. Mit seinen Arbeiten für die Bühne hatte er auch kein Glück. Die Neigung wuchs, sich als verfolgtes Opfer hinzustellen.
Aus dem erfolgreichen Underdog wird so der um seine Position auf dem literarisch-künstlerischen Feld gebrachte Autor. Und auf die Frage, wer solche Ausschlüsse durchsetzen kann, hat Céline die Juden im Kulturleben parat. Alles wird auf einmal sehr einfach und übersichtlich, zumal für den Pazifisten Céline die Juden auch am Krieg schuld sein sollen. Nichts an antisemitischen Attacken ist ihm nun zu krude, um nicht in seinen Anprangerungen verwendet zu werden.
Godard hat keine Entschuldung Célines im Sinn. Aber selbst die wüstesten Passagen - so übersteigert, dass ein kundiger Leser wie André Gide die "Bagatelles" für ein satirisches Spiel halten wollte - sind für ihn im Zeitkontext kein Beleg, dass Céline nach der physischen Auslöschung der Juden getrachtet hätte. Weshalb auch Ernst Jüngers Schilderung im Tagebuch, die einen nach Mord gierenden Céline auftreten lässt - Jünger selbst nahm sie später als Überzeichnung zurück -, von ihm lediglich als Zeugnis einer tiefsitzenden Abneigung des Diaristen gelesen wird.
Dass Jünger von Céline abgestoßen sein musste, liegt auf der Hand. Genauso wie der Umstand, dass Céline für die Nationalsozialisten nicht zum vorweisbaren Antisemiten taugte. Die "Bagatelles" wurden zwar rasch ins Deutsche übersetzt, aber von Obszönitäten gereinigt, umgruppiert, ohne die Abrechnungen mit der Literaturkritik - bis mit "Die Judenverschwörung in Frankreich" ein Buch nach dem Geschmack der Nationalsozialisten vorlag. Schlimm genug natürlich, dass dafür genügend an Text übrig blieb - zum gar nicht kleinen Teil aus einschlägiger Literatur exzerpiert. Aber Célines "Nihilo-Pazifismus", wie es später ein auf Parteilinie liegender Traktat nannte, war für die Nationalsozialisten ungenießbar.
Einigen Kontakten verdankte Céline dann, als sich die deutsche Niederlage abzeichnete, die Möglichkeit der Flucht: quer durch Deutschland, nach Sigmaringen, dann nach Dänemark. Wäre Céline im Sommer 1944 noch in Paris gewesen, hätte er wohl wie Brasillach mit einem Todesurteil rechnen müssen. So wurde es die zweijährige Haft in Dänemark, bevor der Prozess von 1950, ein Jahr später eine Amnestie den Weg zurück nach Frankreich ebneten. Céline empfand, dass ihm schreiendes Unrecht geschehen war - was sein Selbstbild als Opfer vertiefte - und machte sich darüber in Briefen und in den nach dem Krieg entstandenen Büchern auf oft unerträgliche Weise Luft.
Godard spart keinen dieser unangenehmen Züge aus. Um Sympathie für den Autor wird nicht geworben, aber die Bedeutung des frühen wie des späteren Werks mit seiner in Fetzen gehenden Syntax unterstrichen. Natürlich ist der einfachere Weg, sich an die "Reise" zu halten oder die späte "deutsche Trilogie" vor allem für ihre stilistischen Errungenschaften hochzuhalten. Für Godard aber geht es vielmehr darum, die Zusammenhänge wiederherzustellen, die er in solcher Rezeption zerfallen sieht. Wozu für ihn auch gehört, dass irgendwann doch noch einmal eine kommentierte Edition der Pamphlete zustande kommt.
HELMUT MAYER
Henri Godard: "Céline".
Éditions Gallimard, Paris 2011. 593 S., Abb., br., 25,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main