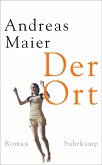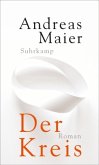Gekonnt intoniert Andreas Maier einen vielstimmigen Chor, der dem Geheimnis eines Filous auf die Schliche zu kommen versucht. Adomeit, über den man in seinem Wetterauer Provinznest mehr Mutmaßungen erzählt als Tatsachen, wird zu Grabe getragen. Über sein Vermögen kursieren wilde Gerüchte, und Skandalöses munkelt man auch über seine Beziehung zur Schwester, die er vor vielen Jahren wegen eines unehelichen Kindes aus dem Haus gejagt haben soll. Adomeit hat seinen Tod so inszeniert, daß die Beerdigung ausgerechnet am Pfingstsonntag stattfindet. Auch für die Testamentseröffnung ist vom Verstorbenen ein unpassender Termin festgelegt worden: der Pfingstdienstag, an dem man im Frankfurter Raum traditionell im Wald zusammensitzt und Wäldchestag feiert. Andreas Maier läßt seinen Erzähler berichten, was er bei den Gesprächen zwischen den Einheimischen und Fremden aufschnappt, was ihm gebeichtet oder vertraulich als todsicher wahr hintertragen wird. So entsteht eine tollkühn erzählte Geschichte über einen gebeutelten Kerl, der der Welt auf beeindruckende Weise eine Nase dreht.

Polnische und deutschsprachige Romane in diesem Herbst
Die Schriftsteller, vor allem polnische und deutsche, ziehen in diesem Bücherherbst in die Provinz. Sie verlassen die Hauptstadt der großen Worte und der großen Gesten. Der Himmel ist überall blau. Das sagte Goethe. Er kannte die Reiseangebote von Neckermann nicht. In Martinique hätte Goethe nur geschwitzt und den "Faust" in den Strand gesetzt. Der Deutschen berühmtester Klassiker favorisierte die Provinz. Denn hier liegt das Land Ur, sind das Urgestein und die Urpflanze daheim. Man muß nicht in der weiten Welt umherschweifen, wenn man im Kleinen die Metamorphose des Ganzen erkennen kann.
Die Literatur findet in diesem Herbst den Ursinn, Vater der fünf Sinne und Mutter aller Gefühle. Sie nimmt ernst, was die ästhetischen Theorien suchen: die Wahrnehmungen. In den fünf Sinnen und in der Sinnlichkeit findet sie den "Sinn" einer Welt, der von den Allüren der Hauptstadt vertrieben wurde. In der Provinz liegt der Schriftsteller ureigenstes Terrain: in den wahrhaft wilden Wiesen des Herzens, nicht im World Wide Web der Verstandesselbstverständlichkeiten.
Es gibt einen Schriftsteller, der das frische Gras der Provinzen gerochen hat: Alexander Kluge. Über zweitausend Seiten lang ist seine "Chronik der Gefühle". Er hat sich mit seinem berühmten Spaten und Feldstecher aufgemacht, die Landkarte der Empfindungen zu vermessen. Aberhunderte von Geschichten stecken wie Fähnchen an den neuralgischen Stellen, dort, wo die Angst, das Vertrauen, der Neid, der Mißmut und die Zuneigung in ihren tausend Gestalten sitzen. Die Gefühle sind die Partisanen, die Begriffe die reguläre Armee. Die einen stehen in den Kasernen, die anderen schwärmen und sind schwer zu fassen, sie haben keine voraussehbare Strategie und lassen sich auf keine Kompromisse ein. Wo sie auftauchen, ist der Mensch nahe dabei, den Ausnahmezustand für sich auszurufen: Man weiß nicht, wie einem geschieht.
Das Gefühl ist ein Partisan
Aus "Geschichte und Eigensinn" - so hieß ein Buch, das Alexander Kluge zusammen mit dem Soziologen Oskar Negt in den politisch erhitzten siebziger Jahren veröffentlichte - wurde eine Geschichte des Eigensinns. Die von Kluge gesammelten Anekdoten ergeben keine große Literatur. Der Herzenskartograph scheut die poetische Gegenwart des Erzählens und verläßt sich auf die Konstellation der Dokumente, die er sortiert. Die "Chronik der Gefühle" ist nicht mit dem Herzblut eines Dichters geschrieben, auch wenn sie von blutenden Herzen berichtet. Das ist das Los aller Schriftsteller, die nicht selbst das Gras sind, das sie wachsen hören. Manchmal kann man zu klug für eine Welt sein, wenn man Hunderte von Welten im Blick hat.
Gefühle ohne Wahrnehmungen gibt es nicht. Deswegen ist es egal, wo eine Geschichte spielt. Sie ist nicht groß, sie ist nicht bedeutend, nur weil die Helden durch die Hauptstadt rennen. Der Raum einer Erzählung wird durch die fünf Sinne abgesteckt. Hören und Sehen müssen einem nicht vergehen, sondern aufgehen, wenn man an den Ort der Poesie kommt.
"Teufelsbrück" hieß - und heißt für den, der nicht lesen will - eine Anlegestelle an der Elbe. Bis Brigitte Kronauer kam und in dieser nördlichen Provinz der großen Literatur ein Zelt aufschlug. Ihr neuer Roman, der den am Fluß gelegenen Flecken im Titel trägt, gibt den Sinnen zurück, was sie an die Begriffe verloren haben: erkennende Verführung und verführende Erkenntnis. Teufelsbrück ist der romantischste Ort der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur. Hier setzte Brigitte Kronauer die Pflanze Ursinn - der Weltsinn aus den fünf Sinnen - in den Boden einer Geschichte, die Blüten nach allen Seiten trieb, Herzensgewächse, die Erkennen und Empfinden miteinander verbinden. Das ist nicht neu bei Brigitte Kronauer, nicht neu in der großen Literatur. Doch in diesem Herbst ist dieser Roman der erotischste, verspielteste Wegweiser in die wundersame Provinz des poetischen Sinns und der Gefühle.
Rund eintausend Kilometer weiter östlich liegt das Städtchen Dukla in den Karpaten. Hier beginnt die poetische Heimat des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk. Ihm sei, erzählt er in seinem Roman "Die Welt hinter Dukla", in den Überresten einer städtischen Toilette eine Erleuchtung zuteil geworden. Das Licht, das auf den Dreck fiel, veränderte seinen Blick auf die Dinge. "Ich hatte eine Gänsehaut. In diesem vergessenen und erodierenden Scheißhaus sah ich die Materie im letzten Stadium des Verfalls, in letzter Verlassenheit. Minuten und Jahre waren in die Dinge eingedrungen und zersetzten sie von innen. Das gleiche wie immer und überall. Sechsunddreißig Jahre hatte ich gebraucht, um hierherzufinden."
Seitdem weiß Stasiuk, daß es eine Welt hinter Dukla gibt: eine Gegend, der Dinge ihre dunkle Seite, ihr Geheimnis, zuwenden, das nur entdecken wird, wer die Dinge zu sehen, aus dem gewohnten Blickwinkel herauszudrehen gelernt hat. In seinem Roman erzählt Stasiuk vom Sehen unter einem sich verändernden Himmel, vom Versuch, der Welt, und zwar in der Provinz, durch die Sinne beizukommen. "Eigentlich tue ich nichts", sagt er, "als die eigene Physiologie zu beschreiben. Die Veränderungen des elektrischen Feldes auf der Netzhaut, Temperaturschwankungen, die unterschiedliche Konzentration von Geruchspartikeln in der Luft, das Oszillieren der Schallfrequenzen. Daraus setzt sich die Welt zusammen. Alles Übrige ist formalisierter Wahnsinn oder die Geschichte der Menschheit."
Dukla heißt nicht nur ein Dorf, sondern seit Stasiuk auch eine Lichtung, die aus den Wahrnehmungen entsteht. Die Dinge werden erlöst, verdrängen aus dem Gesichtskreis des Schriftstellers die Geschichte, die in der Hauptstadt gemacht wird. Auch in den Karpaten führen, als gingen die Philosophen Husserl und Heidegger spazieren, Feldwege in die Poesie.
Vertrauen in die Dinge bewegt auch den polnischen Schriftsteller Stefan Chwin. Sein Roman "Die Gouvernante", der um 1900 spielt und die ganze Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts umfaßt, weckt in einer Villa in der Hauptstadt, die auch die Hauptstadt der Politik ist, die Erinnerungen der fünf Sinne zum Leben. So schnurrt das turbulente Warschau zu einer Provinz der Empfindungen zusammen, die sich an den Dingen entzünden. Wie Ungetüme platzen in dieses heilsame Ambiente die Menschen hinein, denen der Sinn für die Erscheinungsfülle verlorengegangen ist. Sie sind blind für eine Einheit geworden, die einmal die Seele mit den Formen einging. Aber die Welt, die von den fünf Sinnen aufgeschlossen wird, bewahrt auch in diesem Roman einen Ursinn in sich, der einem die Augen für "die Vögel und Lilien auf dem Felde" öffnet: Ein Glaube erwacht in der Natur. Das Gesetz der Provinz, in der die Seele des Menschen ein Zuhause hat, ist die Metamorphose der Dinge, nicht die Züchtung durch den Willen. Die Provinz der Sinne ist der Ort, wo der Mensch sich vor den Eroberungszügen des Verstandes, die in hellem Wahn oder in dumpfer Wissenschaft enden, retten kann.
So viele Gedanken macht man sich in der Wetterau nicht. Der Autor Andreas Meier spielt im Titel seines Debütromans schon den Heimvorteil der Provinz aus: Zum "Wäldchestag" findet man sich ausschließlich in Hessen zusammen. Auf dem Land halten nicht nur die Nahrungsmittel, was sie versprechen. Die Empfindungen sind noch nicht durch den Kakao der Medien und Metropolen gezogen worden. Ein Fremder ist nur ein Fremder, weil er nicht aus demselben Dorf ist, und wenn ein Junge neben einem Mädchen auf der Bank sitzt, dann sitzt die Unbeholfenheit zwischen ihnen. Träume erfüllen sich in der Garage beim Motorfrisieren, das Kinderzimmer daheim bei den Eltern ist der Kokon, aus dem die Abenteuer gesponnen werden. Die fünf Sinne kommen auf ihre Kosten, weil das Plastik der Großstadt nur ausgepackt wird, wenn es in Strömen regnet. Auch am Wäldchestag ist die Welt nicht rund, aber sie bewegt sich in einem Tempo, das man selbst halten kann. Stumpf wird, wer den Absprung in seinen kleinen Traum nicht schafft. Das Dorf ist, Meiers mäandrierender Stil wird dem gerecht, eine Endlosschleife. Man steckt sich eine Kippe an, weil man sich auf Zigarettenlänge aus diesen Kurven tragen lassen möchte.
In der Steiermark sieht das anders aus. Elfriede Jelinek kann einen das Fürchten vor der Provinz lehren. "Gier" lautet der Titel ihres neuen Romans, der den Regionalismus nur in zwei Formen kennt: als vom Menschen malträtierte Natur und als vom Trieb deformiertes Gefühl. Nichts Echtes regt sich weit und breit. Mann und Frau dämmern in der Provinz ihres Unterleibes dahin. Von den fünf Sinnen ist in diesem Land keiner mehr intakt. Sie sind verkümmert, wie alles drum herum verschandelt ist. Der Sinn, der kein Sinn mehr ist, sondern ein tierhafter Körperreflex, steht dem Mann nur noch nach einem. Die Frau hat ihre Sinne bis zur Besinnungslosigkeit degeneriert und verliert sich in der Bereitschaft, das Nachsehen zu haben. Wo die fünf Sinne fehlen, holzt die Axt des Stumpfsinns nieder, was auf Kopfhöhe wachsen möchte. Die Provinz, das ist Elfriede Jelineks Befund, ist überall, im Bett und auf den Bergen. Kein schöner Land als Österreichs Täler und Berge gibt die Aussicht darauf frei, daß das Dorf der Hauptstadt, wo die Gier der Körper sich als Lust an der Macht drapiert, die Diagnose stellen kann.
Helden tragen Scheuklappen
In diesem Bücherherbst findet man auch Romane, die die Hauptstadt in die Provinz verlegen, die große Politik auf das Maß eines Reihenhauses bringen: "Spione" von Marcel Beyer, "Paul Schatz im Uhrenkasten" von Jan Koneffke und "Hampels Fluchten" von Michael Kumpfmüller. Als man die Gesellschaft in die Begriffe zu zwingen versuchte - Alexander Kluge war damals Mitte Vierzig -, tauchte ein Wort auf, das man im Zusammenhang mit diesen drei Romanen verwenden kann: Die Provinz wird instrumentalisiert. Marcel Beyer. Jan Koneffke und Michael Kumpfmüller haben selbst weder den Zweiten Weltkrieg noch die DDR erlebt. Sie kennen, wie könnte das bei ihrer Generation anders sein, was geschah, nur aus den Archiven oder aus Erzählungen. Aus welchen Motiven heraus sie sich einer Vergangenheit zuwenden, die nur vermittelt die ihre ist, darüber kann man rätseln. Sie sehen die Fallgruben und versuchen, sich mit einem Kunstgriff aus der Affäre zu ziehen. Entweder sie erzählen, was damals geschah, aus der Perspektive von Kindern, wie Beyer und teilweise Koneffke, oder sie laden die große Politik nach Hause zum Kaffeetrinken ein. Bei allen drei Versuchen, die deutsche Vergangenheit in einer Geschichte zu fassen, hilft die Provinzialisierung des Blicks. Gerät die Politik in die Provinz, machen Helden, die an allen fünf Sinnen Scheuklappen tragen, Geschichte.
Die Provinz der fünf Sinne ist die auffälligste Erscheinung in diesem Bücherherbst. Wer auf die Literatur hofft, der darf seinen Blick ruhig über diese Provinz schweifen lassen. Nirgendwo anders ist der Schriftsteller besser an seinem Platz als hier. Diese Provinz, das zeigen die neuen deutschen und polnischen Romane, könnte versöhnen, was die Welt der Hauptstädte angerichtet hat. Die fünf Sinne sind die Partisanen eines Glücks, von dem nur die Schriftsteller zu erzählen vermögen.
EBERHARD RATHGEB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kein anderer Debütant, stellt Rezensent Hubert Spiegel beeindruckt fest, habe die literarische Szene mit so selbstbewusst betreten wie Andreas Maier, Und welche Vorgänger das sind, hat er uns teilweise sogar schon verraten: in der Hauptsache Thomas Bernhard, von dem eer den Tonfall habe, den häufigen Gebrauch des Konjunktivs und den "Beobachtungszwang". Aber auch Eckhard Henscheid und dessen Liebe zum Geschwätz sowie den mikroskopischen Blick Arnold Stadlers auf das Dorf. Spiegel feiert das Buch, Vorbild Thomas Bernhard als Messlatte immer im Blick. Das macht einen als Leser stutzig, und man mag diese Begeisterung nicht teilen. Wir lesen, Maier schere sich nicht um den logischen Vorwurf der Epigonalität. Spiegel möchte sich gerne auch nicht darum scheren, fragt dann aber schließlich doch: "Was ist Andreas Maier wohl für einer? Und was glaubt er, wer er sei?"
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein zwiespältiges Lob auf die Provinz haben schon viele Autoren gesungen, aber seit langem hat es keiner mehr so brillant getan wie jetzt Andreas Maier. ... Er hat ein erstaunliches Debüt vorgelegt - in mehr als einer Hinsicht. ... Es ist sehr zu hoffen, daß dieses irritierende Glanzstück viele Leser findet.« Edo Reents Süddeutsche Zeitung 20001018