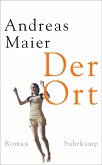»Es ist, als sei allem etwas entzogen worden, wie durch einen chemischen Vorgang, eine Substanz, die nicht mehr in den Dingen vorhanden sei, obgleich sie doch eigentlich in ihnen vorhanden sein müßte. « Was aber, wenn die Dinge auch zuvor nie von einer Substanz durchdrungen waren? So wie all die Geschichten, die sich um den Niederflorstädter Sebastian Adomeit ranken, der als asketischer Konsumverweigerer und als Daseinssuchender sich stets von der dörflichen Biederkeit und der alltäglichen Infamie absetzte. Auch noch nach seinem Ablebenzieht er den Unmut der Dorfbewohner auf sich, indem er kurz vor seinem Tod den Pfingstdienstag, der im Raum Frankfurt traditionell als 'Wäldchestag' gefeiert wird, als Tag für die Testamentseröffnung auswählte. Ein Affront gegen die lokalen Gepflogenheiten. Spekulationen der gerüchtebesessenen Dörfler um die Person des intellektuellen Sonderlings setzen ein und stiften Verwirrung, so daß selbst der Erzähler, einer der wenigen Vertrauten des Verstorbenen, zugeben muß, nicht mehr erkennen zu können, »was von dieser Geschichte tatsächlich passiert sei«.
Andreas Meier wurde 1967 in Bad Nauheim geboren. Im Frühjahr 2002 erschien im Suhrkamp Verlag sein zweiter Roman Klausen.
Andreas Meier wurde 1967 in Bad Nauheim geboren. Im Frühjahr 2002 erschien im Suhrkamp Verlag sein zweiter Roman Klausen.

Andreas Maiers großes Debüt "Wäldchestag" · Von Hubert Spiegel
In der Wetterau ist der Mensch dem Menschen ein Rätsel. Zwei Fragen sind es, die der Wetterauer dem Wetterauer stellt. Die eine - Was ist das eigentlich für einer? - stellt er heimlich, im stillen, ganz für sich allein, die andere - Was glaubt der eigentlich, wer er sei? - stellt er laut und fast immer in Gesellschaft. Nicht selten stellt er sie in geradezu dröhnender Lautstärke, und mitunter haut er dabei mit der Faust auf den Tisch, um sein ganzes Interesse an ihr zu unterstreichen. Die eine Frage stellt er in der eigenen Kammer, die andere mit Vorliebe im Gasthaus. Die erste Frage bedrängt den, der sie stellt, die zweite jenen, dem sie gestellt wird.
Der Wetterauer geht nicht den Dingen, wohl aber den Menschen gern auf den Grund, und wenn er dabei unversehens ins Bodenlose fällt, wundert er sich, wie ihm nun das wieder passieren konnte. Und schon denkt der Wetterauer über sich selbst nach, und wenn er nur recht über sich selbst nachdenkt, wird der Wetterauer sich selbst mit einem Mal ganz unverständlich, und der Riß, der durch die Welt geht, tritt in der Wetterau ganz offen zutage, unübersehbar geht der Riß durch die Wetterau und durch den Wetterauer selbst, der darüber ganz melancholisch wird, aber auch in einen Zorn hinein gerät und in große Verwirrung. In dieser Verwirrung beginnt der Wetterauer zu reden, was das Zeug hält. Wenn er jung ist, redet er über sich selbst. Wenn er älter ist, redet er über andere. Und dieses gemeinsame, ununterbrochene Gerede schwillt an, bis es mächtig wird in der ganzen Wetterau, mächtig bis nach Frankfurt und über Frankfurt hinaus, mächtig bis ans Ende der Welt, wo noch niemand war, das der Wetterauer aber irgendwo in Südhessen vermutet.
Daß selbst hier, am Ende der Welt, heute jedermann wissen kann, wie es zugeht in der Wetterau, verdanken wir dem ersten Roman von Andreas Maier, gebürtig im Jahr 1967 in Bad Nauheim, einem unbedeutenden Nachbarort jenes Butzbach, das Thomas Bernhard in seinem Drama vom "Theatermacher" unsterblich gemacht hat, auch wenn er aus Gründen der Butzbach-Freundlichkeit den ersten Buchstaben wegließ und milde von Utzbach sprach - "Utzbach wie Butzbach". Wer sich je gefragt hat, wie wohl das Publikum aussehen mag, das der Theatermacher Bruscon haßt und verachtet und braucht und liebt und das in Bernhards Stück den Saal im Utzbacher Gasthaus "Zum Schwarzen Hirschen" fluchtartig verläßt, noch bevor der Vorhang sich gehoben hat, muß Maiers Debütroman "Wäldchestag" lesen.
Wie Bernhards Utzbacher gehen auch Maiers Wetterauer kaum je ins Theater, und wenn, dann höchstens aus Niedertracht der Schauspielkunst gegenüber, sie brauchen das Theater nicht, denn sie sind das Theater, eine Menschheitskomödie, die naturgemäß auch eine Tragödie ist. Bei Maier beginnt sie mit der Beerdigung des alten Adomeit, eines Einzelgängers und Sonderlings, am Pfingstsonntag und endet mit dem Nervenzusammenbruch des jungen Florstädter Taugenichts Anton Wiesner am Wäldchestag, dem Dienstag nach Pfingsten, den man in Hessen traditionellerweise essend, trinkend und schwatzend in der freien und wehrlosen Natur verbringt, im Wäldchen eben. Zwischen beiden Ereignissen liegen Leichenschmaus und Testamentseröffnung, Intrigen und Familienstreitigkeiten, Liebesgeschichten und Besäufnisse, liegen also jene drei Tage, von denen der Roman erzählt, und zwar auf eine Weise erzählt, daß man dem Debütanten zwei Fragen stellen möchte, die beiden Wetterau-Fragen nämlich: Was ist Andreas Maier wohl für einer? Und was glaubt er eigentlich, wer er sei?
Was ist das für einer, der einen ganzen Roman im Konjunktiv erzählt, der wild die Perspektiven wechselt, der seinen Figuren ohne jede Scham in die Köpfe hineinleuchtet, aber seine Leser im unklaren darüber beläßt, wer es eigentlich ist, der hier die Taschenlampe hält? Der eine ganze Ortschaft, das an und für sich nicht weiter bemerkenswerte Nieder-Florstadt nämlich, in einen Rausch aus Tratsch und Gerüchten, Mirabellenschnaps und Apfelwein, Neid und Verleumdung, Mißgunst und Klatschsucht stürzt und die irrwitzigen Gesprächs- und Gedankenprotokolle dieser drei Tage am Ende als Bericht "zur Vorlage an die Kommission zur Bewilligung von Kuren auf Beitragsbasis der hiesigen Kassenstelle" deklariert?
Und was bildet sich eigentlich einer ein, der seinen Debütroman vom ersten bis zum letzten Satz wie eine Imitation oder Parodie auf das Werk Thomas Bernhards klingen läßt, ohne sich um den unausweichlichen Vorwurf der Epigonalität zu scheren? Maier übernimmt nicht nur den exzessiven Gebrauch des Konjunktivs, der ironisiert und distanzierend bricht, was im Roman berichtet wird, von Bernhard, sondern er teilt auch die Beobachtungsgabe, vielleicht den Beobachtungszwang des Österreichers.
Jener Satz, den Bernhard seinem Romandebüt, dem 1963 erschienenen Roman "Frost", voranstellte, könnte ebensogut über "Wäldchestag" stehen. Die Frage des Malers Strauch aus "Frost" ist auch die Frage, die den alten Adomeit bewegt haben mag: ",Was reden die Leute über mich?', fragte er. ,Sagen Sie: der Idiot? Was reden die Leute?'"
Das Gerede der Leute, vor allem aber die Frage: Wie reden die Leute?, ist das eigentliche Thema dieses Romans. "Wäldchestag" besteht zum großen Teil aus nichts anderem als der konjunktivischen Wiedergabe von Geschwätz und Gesprächen, von Gerede, das die häufig, oft beinahe unmerklich wechselnden Erzähler zuweilen nicht einmal selbst mitangehört haben, sondern nur aus den Berichten Dritter kennen. "Wäldchestag" ist ein Roman über die Macht des Hörensagens und die verschiedenen Aggregatzustände des Gerüchts: Es ist zäh und ledern, dünnflüssig und quecksilbrig, labil wie ein Kartenhaus und unverwüstlich wie ein Panzerkreuzer. Wie Öl, das aus einem lecken Tank fließt, dringen Mutmaßungen und Unterstellungen in alle Wetterauer Winkel und Ritzen.
Kein anderer Debütant hat in diesem Jahr mit soviel Selbstbewußtsein und sowenig Respekt vor großen Vorgängern die literarische Szene betreten wie Andreas Maier. Keiner hat mehr gewagt und mehr erreicht. Von Eckhard Henscheid, dessen "Trilogie des laufenden Schwachsinns" das Kneipengeschwafel literaturfähig machte, hat Maier die Liebe zum Geschwätz, von Thomas Bernhard den Tonfall, von Arnold Stadler den mikroskopischen Blick auf das Dorf als Lebensgemeinschaft und Lebensgegnerschaft übernommen, und der Debütant hat aus diesen und vielen anderen Anleihen etwas unverwechselbar Eigenes gemacht: einen Roman, der den Umweg als interessanteste Verbindung zwischen zwei Punkten feiert, der grandios umständlich ist und kontrolliert ausufernd, dessen Sprache daherrauscht wie junger Apfelwein und dessen Beschreibungskunst zum Witzigsten gehört, was die deutsche Literatur seit langem hervorgebracht hat.
Das "Schlaganfallklima" der mit dem alten Adomeit weitläufig verwandten Familie Mohr, Tante Lenchen, ein achtzigjähriges Renitenzbündel, das noch immer seinen NSDAP-Ausweis in der Handtasche aufbewahrt, um jederzeit die Famile blamieren zu können, der Nieder-Florstädter Renovierungswahn ("die Kirchgasse zwanzig ist überfällig, sie ist so reif wie ein Apfel im Herbst"), Schossaus Notwendigkeitssucht und Wiesners Liebes- und Lebenskrankheit - all dies ist nicht nur glänzend beobachtet und beschrieben, sondern zugleich von größter Komik, einer Komik, die frei ist von der ätzenden Schärfe und der Haßliebe eines Thomas Bernhard. Bernhard, der Übertreibungskünstler, bezog seine Komik aus den ins Groteske übersteigerten Eigenheiten seiner Figuren, aus ihrer Weltwut und Lebensangst, ihrer Hypochondrie und Tyrannei. Maiers Komik kommt direkt aus der Banalität der Figuren, die nicht vergröbert, sondern nur verdeutlicht werden. Selbst in den beklemmenden Szenen, die der Testamentseröffnung gelten, wenn Habgier, Mißgunst und Trunkenheit eine geradezu pogromartige Stimmung erzeugen, wird deutlich, daß hier nicht nur ein virtuoser Sprachmimetiker und Situationskomiker am Werke ist, sondern auch ein großer Realist. Nicht rümpfend, sondern witternd reckt Andreas Maier seine Nase in den Wind. Er hat ihn längst über die Wetterau hinaus getragen.
Andreas Maier: "Wäldchestag". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 315 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein zwiespältiges Lob auf die Provinz haben schon viele Autoren gesungen, aber seit langem hat es keiner mehr so brillant getan wie jetzt Andreas Maier. ... Er hat ein erstaunliches Debüt vorgelegt - in mehr als einer Hinsicht. ... Es ist sehr zu hoffen, daß dieses irritierende Glanzstück viele Leser findet.« Edo Reents Süddeutsche Zeitung 20001018
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kein anderer Debütant, stellt Rezensent Hubert Spiegel beeindruckt fest, habe die literarische Szene mit so selbstbewusst betreten wie Andreas Maier, Und welche Vorgänger das sind, hat er uns teilweise sogar schon verraten: in der Hauptsache Thomas Bernhard, von dem eer den Tonfall habe, den häufigen Gebrauch des Konjunktivs und den "Beobachtungszwang". Aber auch Eckhard Henscheid und dessen Liebe zum Geschwätz sowie den mikroskopischen Blick Arnold Stadlers auf das Dorf. Spiegel feiert das Buch, Vorbild Thomas Bernhard als Messlatte immer im Blick. Das macht einen als Leser stutzig, und man mag diese Begeisterung nicht teilen. Wir lesen, Maier schere sich nicht um den logischen Vorwurf der Epigonalität. Spiegel möchte sich gerne auch nicht darum scheren, fragt dann aber schließlich doch: "Was ist Andreas Maier wohl für einer? Und was glaubt er, wer er sei?"
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH