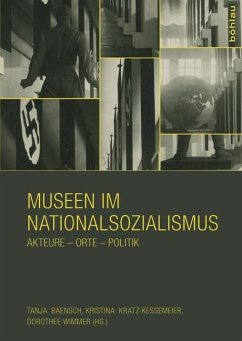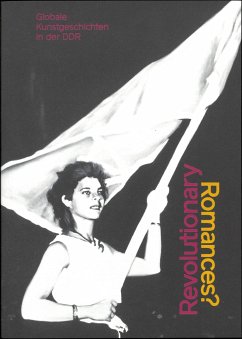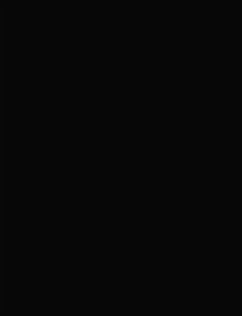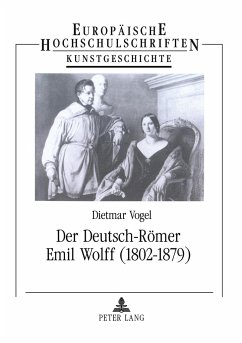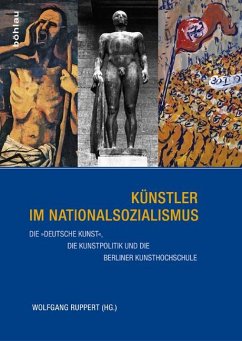Wahlplakate der Spitzenkandidaten der Parteien
Die Bundestagswahlen von 1949 bis 1987

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie präsentieren sich die konkurrierenden Parteien in den Wahlkämpfen der wechselvollen Jahrzehnte zwischen 1949 und 1987? In allen Kampagnen ist das Medium Plakat omnipräsent, das von Porträts des jeweiligen Spitzenkandidaten dominiert wird. Auf der Basis umfangreicher Archivrecherchen weist die Autorin nach, dass die Gestaltungsstile zwischen dem Corporate Design der Parteien und den für einzelne Kandidaten entwickelten, individuellen Mustern changieren. Ob sich dabei Trends der jeweils aktuellen Konsumwerbung abbilden oder welche Reflexe aus Tradition und zeitgenössischen Wahlkämpfen...
Wie präsentieren sich die konkurrierenden Parteien in den Wahlkämpfen der wechselvollen Jahrzehnte zwischen 1949 und 1987? In allen Kampagnen ist das Medium Plakat omnipräsent, das von Porträts des jeweiligen Spitzenkandidaten dominiert wird. Auf der Basis umfangreicher Archivrecherchen weist die Autorin nach, dass die Gestaltungsstile zwischen dem Corporate Design der Parteien und den für einzelne Kandidaten entwickelten, individuellen Mustern changieren. Ob sich dabei Trends der jeweils aktuellen Konsumwerbung abbilden oder welche Reflexe aus Tradition und zeitgenössischen Wahlkämpfen in den USA wie Europa zu erkennen sind, beantwortet dieser politikhistorisch orientierte, bildwissenschaftliche Überblick über die visuelle Wahlkampfführung in der Bundesrepublik Deutschland vor 1989.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.