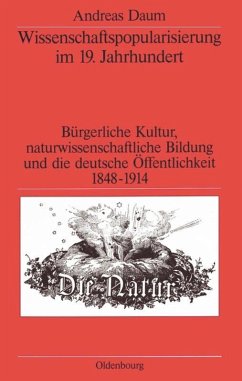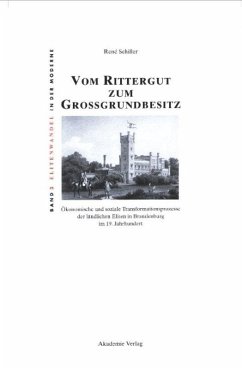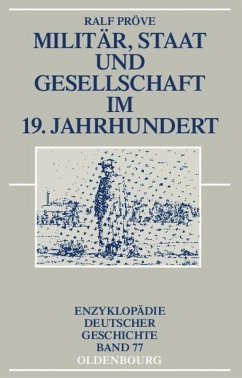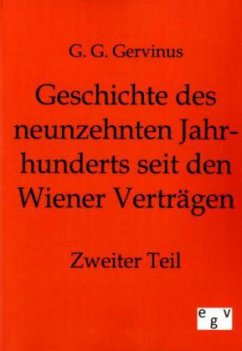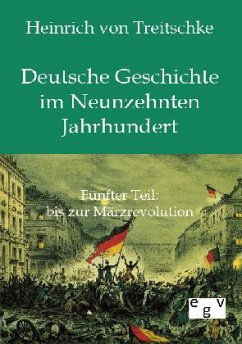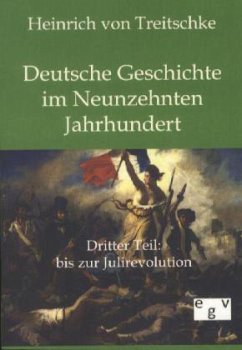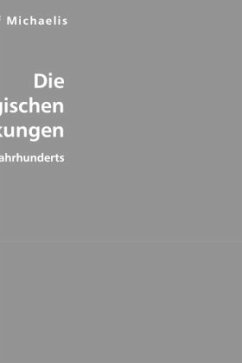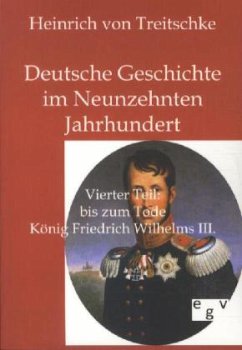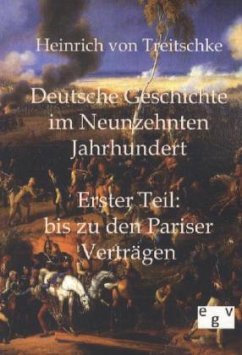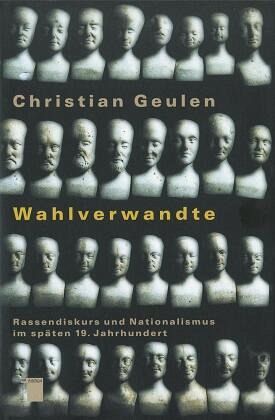
Wahlverwandte
Rassendiskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
35,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Christian Geulen rekonstruiert die Dynamik rassentheoretisch begründeter Formen nationaler Identifikation, die in der fatalen Behauptung mündete, die Nation sei biopolitisch herstellbar.Der Rassendiskurs beruhte nie allein auf dem schlichten Glauben an ewige Unterschiede, sondern vor allem auf einem instrumentellen Wissen vom Leben und Überleben der Körper und Bevölkerungen. Im Horizont dieses Wissens erschienen politische Gemeinschaften ebenso natürlich gegeben wie künstlich herstellbar. Aus Partikularität und Differenz wurde ein manipulierbares Objekt biopolitischer Kontrolle. Das Er...
Christian Geulen rekonstruiert die Dynamik rassentheoretisch begründeter Formen nationaler Identifikation, die in der fatalen Behauptung mündete, die Nation sei biopolitisch herstellbar.
Der Rassendiskurs beruhte nie allein auf dem schlichten Glauben an ewige Unterschiede, sondern vor allem auf einem instrumentellen Wissen vom Leben und Überleben der Körper und Bevölkerungen. Im Horizont dieses Wissens erschienen politische Gemeinschaften ebenso natürlich gegeben wie künstlich herstellbar. Aus Partikularität und Differenz wurde ein manipulierbares Objekt biopolitischer Kontrolle. Das Erbe dieser Verschränkung von Rassendiskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert wirkt bis heute nach.
Der Rassendiskurs beruhte nie allein auf dem schlichten Glauben an ewige Unterschiede, sondern vor allem auf einem instrumentellen Wissen vom Leben und Überleben der Körper und Bevölkerungen. Im Horizont dieses Wissens erschienen politische Gemeinschaften ebenso natürlich gegeben wie künstlich herstellbar. Aus Partikularität und Differenz wurde ein manipulierbares Objekt biopolitischer Kontrolle. Das Erbe dieser Verschränkung von Rassendiskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert wirkt bis heute nach.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.