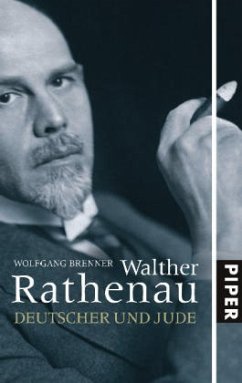Erfolgreicher Großindustrieller im Vorstand der AEG, strategisch denkender Politiker, umtriebiger Erfinder, Philosoph und Schriftsteller: Walther Rathenau (1867 1922) ist eine ungemein komplexe und faszinierende Figur der deutschen Geschichte. Keine andere Persönlichkeit hat die Epoche des Übergangs vom Kaiserreich zur Republik so geprägt wie er. In seiner Wandlung vom preußischen Patrioten zum Demokraten verkörpert er beispielhaft jene Zeit des Umbruchs, deren Kenntnis heute jedem tieferen Verständnis der Jahre 1933 bis 1945 vorauszugehen hat. Denn mit Rathenaus Ermordung scheiterte auch die andere Möglichkeit der Geschichte: die Schaffung eines neuen demokratischen Deutschlands, für das dieser Mann stand und für das er sterben mußte. Gerade sein tragisches Leben im Spannungsfeld zwischen Geist und Macht aber eröffnet einen unverstellten Blick auf die deutsche Vergangenheit: Was wäre gewesen, wenn der Jude Rathenau nicht von seinen rechten Hassern ermordet worden wäre?

Vielfach diskriminiert und doch erfolgreich: Wolfgang Brenner rückt Walther Rathenau zu Leibe / Von Andreas Platthaus
Walther Rathenau ist eine jener Figuren, für die man im Englischen die schöne Bezeichnung geprägt hat, sie seien "larger than life". Aber kann eine Persönlichkeit wirklich noch größer sein als dieses 1867 begonnene und 1922 gewaltsam beendete Leben? Rathenau war der Sohn eines der größten deutschen Unternehmer, des AEG-Gründers Emil Rathenau, er selbst rief auf der Grundlage eigener chemischer Forschungen einen Betrieb in Bitterfeld ins Leben, der zur Keimzelle des mitteldeutschen Chemiedreiecks und damit einer der wichtigsten Industrieregionen Deutschlands wurde, er arbeitete als Bankier und saß in mehr Aufsichtsräten, als es sich Hermann Josef Abs je hätte träumen lassen, er war Erfolgsautor, wurde Präsident der AEG, organisierte im Ersten Weltkrieg die deutsche Rohstoffversorgung, bekleidete in der Weimarer Republik zweimal Ministerämter, führte den Ausgleich des Deutschen Reichs mit der Sowjetunion herbei und starb im Kugelhagel von Rechtsterroristen, die mit ihm dem ganzen demokratischen System den Todesstoß versetzen wollten.
Doch da ist mehr als dieses Leben. Da ist ein Geist, der von seinen Zeitgenossen als provozierend empfunden wurde, ein jüdischer Geist, der mit aller Macht für Assimilierung kämpfte und dennoch niemals den Übertritt zum christlichen Glauben für sich in Erwägung zog. Und da war eine Seele, die nicht verwinden konnte, daß sie im Außenseiterstatus verharren sollte, gleich mehrfach diskriminiert durch religiöse Herkunft, politische Ambitionen, familiäre Rivalitäten und sexuelle Präferenzen.
Überreicher Stoff also. Man könnte Romane darüber schreiben. Robert Musil hat es mit seiner literarischen Inhaftierung Rathenaus als Dr. Arnheim im "Mann ohne Eigenschaften" getan - und seitdem alle anderen Romanciers abgeschreckt. Auf dem Feld der Biographik dagegen herrscht Überfülle. Herrmann Brinckmeyer veröffentlichte nach dem Mord eine belanglose Familiengeschichte über Vater und Sohn ("Die Rathenaus", 1922), doch mit Harry Graf Kesslers Biographie erschien 1928 das erste gründlich gearbeitete Werk über Walther Rathenau, und seitdem sind ein rundes Dutzend weitere Lebensbeschreibungen publiziert worden. Aber immer noch fehlt eine wissenschaftliche Biographie.
Die liefert auch Wolfgang Brenner nicht. Doch dürfte der Publizist mit seiner Studie die Rathenau-Forschung unter Druck setzen, endlich die Lücke zu schließen. Die Umstände für die Forschung sind immer noch prekär: Ein wesentlicher Teil des Nachlasses liegt im "Zentrum für die Aufbewahrung historischer und dokumentarischer Sammlungen" in Moskau. Als die Rote Armee das Landschloß Freienwalde erreichte, Rathenaus ehemaliges Wochenenddomizil, wo eine Gedenkstätte sogar die Nazi-Zeit überdauert hatte, nahm sie das Inventar als Kriegsbeute mit - Rathenaus Wirken war durch den von ihm als Außenminister 1922 mitausgehandelten Vertrag von Rapallo eng mit der Geschichte der Sowjetunion verknüpft. Bis heute ist dieser Bestand der Forschung weitgehend unzugänglich.
Brenner hat eine sehr gut lesbare Biographie geschrieben, die jedoch vor gewagten Thesen nicht zurückschreckt. So wird die von Rathenau maßgeblich bestimmte deutsche Erfüllungspolitik gegenüber den Siegermächten im Ersten Weltkrieg auf einen "Reflex der Demut" zurückgeführt, den er in der Kindheit gegenüber dem herrischen Vater entwickelt habe. Überhaupt wird viel populärpsychologisiert in diesem Buch, das sich dazu auch Rathenauscher Kategorien wie etwa der Unterscheidung von Furcht- und Mutmenschen bedient. Die Nähe des Autors zu seinem Gegenstand ist so groß, daß man oft die Bezeichnung "Walther" statt "Rathenau" findet. Die Absicht ist klar: Hier soll lebendig erzählt werden. Aber im Gegensatz zu Rathenau schreibt Brenner nicht aus innerer Notwendigkeit.
Rathenau ließ keinen Zweifel daran, daß für ihn nur das zählte, was er schrieb. Und er schrieb dabei um mehr als sein Leben - weil er nicht als Multimillionär, Organisator, Minister in Erinnerung bleiben wollte, sondern als Vordenker. Der für seinen Anspruch programmatische Buchtitel ist "Von kommenden Dingen", 1917 im Krieg erschienen - das meistverkaufte unter seinen Büchern. Doch zugleich auch in der Wirkung das kurzlebigste. Rathenau wußte zwar 1917 bereits, daß Deutschland nicht mehr siegen würde. Aus dem unabwendbaren inneren Zusammenbruch - der für ihn aber noch nicht die äußere Niederlage bedeutete - sah er aber einen stärkeren, sozial gewandelten "Volksstaat" entstehen, dessen Organisation das Beste aus Kapitalismus und Sozialismus verbinden sollte.
Kein Wunder also, daß seine Vorstellung vom Kriegsende eine deutsche levée en masse war und nicht die Revolution. Doch als der Krieg dann verlorenging, wurden diese Prognosen von der Wirklichkeit überholt. Der Umsturz aber war für Rathenau nur ein Straucheln. Niemand aus der Klasse derer, die schließlich aus den Wirren gestärkt hervorgingen, spottete nach dem Krieg treffender als er: "Die Kette fiel ab, und die Befreiten standen verblüfft, hilflos, verlegen und mußten sich wider Willen rühren. Den Generalstreik einer besiegten Armee nennen wir deutsche Revolution."
Rathenau war auch ein exzessiver Briefeschreiber, und erst in der Korrespondenz ist er ganz bei sich. Seine Briefwechsel mit der Familie, mit dem Freund und Verleger Maximilian Harden, mit der vergötterten Lili Deutsch, die unglücklicherweise mit dem mächtigsten Direktor der AEG verheiratet war, mit Politikern, Künstlern, Militärs sind von einer Intensität, die der seiner Gesellschaftsphilosophie in nichts nachsteht, ja vieles schärfer faßt als die Schriften. In seinen Briefen an den Generalquartiermeister Erich Ludendorff etwa steckt schon das Grundgedankengut aus "Von kommenden Dingen", in der Korrespondenz mit Harden das Mißtrauen gegenüber dem revolutionären Überschwang von 1918.
Das bemerkenswerteste schriftliche Gespräch aber muß das zwischen Lili Deutsch und Rathenau gewesen sein. Man kann die Größe des Verlustes für unser Rathenau-Bild erahnen, wenn man die Abschriften heranzieht, die Graf Kessler in seiner Biographie verwendet. Doch das ist nur ein spärlicher Rest, denn ihre Briefe verbrannte Rathenaus Mutter nach der Ermordung des Sohnes, und die seinen sind mit Lili Deutsch verschollen, die als Jüdin 1939 nach Belgien emigrierte und von dort vor dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 floh. Wohin, weiß niemand,
Brenner behauptet es zu wissen: Lili Deutsch habe sich auf ein Schiff nach Amerika gerettet, das dann von einem deutschen Torpedo versenkt worden sei. Dabei hat Ernst Schulin schon vor zwölf Jahren festgestellt, daß es in den Unterlagen der Familie von Lili Deutsch keinen Hinweis auf solch ein Unglück gibt. Brenner hat die Literatur zu Rathenau, gerade die wissenschaftliche, äußerst selektiv ausgewertet - um es höflich auszudrücken. Weder der Katalog zur Rathenau-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum von 1993 noch der extrem ertragreiche und auch kontroverse Band "Ein Mann vieler Eigenschaften" mit den wichtigsten Texten eines 1989 durchgeführten Berliner Rathenau-Kolloquiums wurde von Brenner ausgewertet.
Seine Quellengrundlage sind die Textausgaben und die anderen biographischen Studien. Diese Materialmasse ist geschickt kompiliert, auch wenn man sich einige Stilblüten lieber erspart und ein paar Nachlässigkeiten gern korrigiert gesehen hätte. So erfährt man mit Staunen, daß Bismarck als Reichskanzler Anfang der achtziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts schon geschaßt gewesen sei, andererseits aber 1904 Maximilian Harden noch zu frugalen Abendessen eingeladen habe.
Brenners Buch ist da am besten, wo es statt ins Analysieren ins Erzählen kommt, wo nicht historische Akkuratesse gefragt ist (der Text springt ohne Rücksicht auf die Chronologie), sondern Einfühlung in die Person Rathenau. Einen historiographischen Tiefschlag aber versetzt Brenner seinem Gegenstand: Erst stellt er fest, daß Rathenau durch seinen "exponierten Fatalismus" die Mörder schon besiegt habe, "bevor sie überhaupt antraten". Doch die letzten zwanzig Seiten des Buches widmen sich ganz der Aufspürung der Täter - eine tolle Räuberpistole, fürwahr, doch zu Rathenau gibt es kein Wort mehr. Das letzte Wort behalten so doch seine Mörder.
Was bleibt von Brenners Rathenau? Viele Fakten, aber kein schlüssiges Bild. Das ist immerhin etwas, denn so steht Rathenau weiter im Fokus. Möge es ihm nie ergehen wie jenem Herrn, den Brenner bei dessen einzigem Auftritt als "einen gewissen Hellmut von Gerlach" vorstellt. Gerlach ist heute tatsächlich so gut wie vergessen, dabei ist sein Leben nicht minder faszinierend als das von Rathenau: vom ostelbischen Junker zum Chefredakteur der demokratischen Wochenzeitung "Welt am Montag", Reichstagsabgeordneter, Leiter der "Weltbühne" in Vertretung des verhafteten Ossietzky, schließlich Flüchtling vor den Nazis. Gerlach ist als Figur heute "smaller than life". Ein historischer Mythos entsteht eben nur auf der Basis gesammelten Wissens. Zu den Sammlern zählt Brenner.
Wolfgang Brenner: "Walther Rathenau". Deutscher und Jude. Piper Verlag, München 2005. 520 S., 33 Abb. auf Tafeln, geb., 26,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Gut erzählt, aber mit leichten Schwächen bei der historischen Darstellung sei diese Rathenau-Biografie, resümiert Rezensent Christoph Jahr. Auf jeden Fall zeige sie einmal mehr, dass die Figur Rathenau nach wie vor "fasziniert", auch wenn sie nicht mehr "polarisiert". Charakteristisch sei seine in allen Bereichen "schwankende" Natur, zwischen Handeln und Zaudern, "freundschaftlicher Nähe und Distanz", und nicht zuletzt seine latente Homosexualität und das heikle Verhältnis zu Frauen. Als Wirtschaftslenker, Politiker, Kunstmäzen und Publizist habe Rathenau vieles angestoßen, doch nur wenig beendet. Der Rezensent vermisst an Wolfgang Brenners Biografie allerdings sowohl eine "Bilanz" als auch einen Blick auf die "größeren Zusammenhänge". Ausgespart sei zudem, auf welche Weise Rathenau zu verschiedenen Zeiten von unterschiedlichen Gruppen politisch vereinnahmt worden sei. Eine "definitive Biografie", so der Rezensent, stehe somit noch aus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH