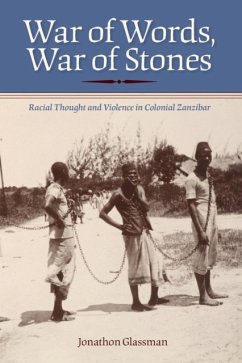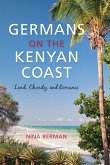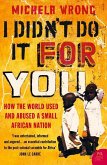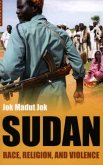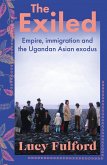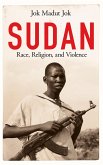Jonathon Glassmans brisante Studie zeigt, dass sich das Rassedenken auch afrikanischen Traditionen verdankt
"Rassen", argumentierte der in Princeton lehrende britisch-ghanaische Philosoph Kwame Anthony Appiah in seinem vor zwanzig Jahren publizierten preisgekrönten Essayband "In my Father's House", gibt es nicht; der Begriff sei fatal, weil er Kulturen und Ideologien biologisiere. Die Probleme etwa "der Schwarzen" seien nur zu lösen, so Appiah weiter, wenn sie nicht als Produkt eines vermeintlichen Anderssein gedeutet werden, sondern als menschliche Probleme, die aus einer spezifischen Situation erwachsen. Appiah wusste sich einig mit den Naturwissenschaften, dass jede biologische Grundlage für die Einteilung der Menschen in "Rassen" fehlt.
Doch bleibt das Reden über "Rasse" auch zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts ein zentrales Signum gesellschaftlicher Diskurse und Konflikte. Das Denken in Rassekategorien wird in der Regel als distinkt westliche Erfindung angesehen, die im Laufe der imperialen Expansion die anderen Weltteile erreichte. Diese Sichtweise bedarf, wie der an der Northwestern University in Evanston lehrende Afrikahistoriker Jonathon Glassman in seiner provokanten Studie am Beispiel Sansibars zu zeigen versucht, der Differenzierung. Er untersucht die intellektuellen Wurzeln des Rassedenkens auf der ostafrikanischen Nelkeninsel, die häufig als Inbegriff transnationaler, ja kosmopolitischer Kultur gilt.
Dort kam es am Vorabend der 1964 erfolgten Unabhängigkeit jedoch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die sich verschiedenen "Rassen", nämlich der "afrikanischen" oder der "arabischen Rasse" zugehörig fühlten.
In den letzten Jahren rücken zunehmend jene Diskurse afrikanischer Intellektueller ins Blickfeld der Afrika-Historiographie, die lange als "tribalistisch" oder bestenfalls "sub-nationalistisch" etikettiert wurden. Zugleich ist die Einsicht gewachsen, dass Ethnizität keineswegs ausschließlich ein ideologisches Konstrukt der Europäer war, welches dann von afrikanischen Politikern übernommen wurde. Ethnisches Denken in Afrika hatte viele, eben auch lokale Quellen. Es sei in diesem Zusammenhang wenig sinnvoll, argumentiert Glassman, Rassedenken und Ethnizität als völlig unterschiedliche Kategorien zu betrachten. Denn beide Denkweisen teilten zwei zentrale Elemente: Erstens die Annahme, dass die Menschheit aus einer Reihe von klar unterscheidbaren "Völkern" besteht, die über eine jeweils eigene, authentische und homogene Kultur verfügen.
Und zweitens die Metapher der Herkunft, das heißt die Vorstellung, dass die Menschen, die einem Volk oder einer Kultur angehören, durch irgendeine Form von Blutsverwandtschaft verbunden sind. Glassman plädiert in seiner differenzierten Diskussion der bisherigen sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschungsansätze zum Thema "Rasse" für ein Konzept, welches die Fixierung auf wissenschaftliche Doktrinen aufgibt und Rassedenken als ein sich beständig verschiebendes diskursives Feld deutet, in dem Rassismus nur eine mögliche Form darstellt.
Auf Sansibar waren, wie der Autor auf profunder Quellenbasis zeigt, westliche Vorstellungen von Rasse, Ethnizität und Nation keineswegs irrelevant. Sie konstituierten jedoch nur einen Teilaspekt des politischen Diskurses, den lokale Intellektuelle im Rahmen der nationalistischen Mobilisierung nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten. Der Diskurs der sehr kosmopolitisch ausgerichteten Gruppe sansibarischer Intellektueller schöpfte aus einem breiten Spektrum von fremden und einheimischen intellektuellen Traditionen.
Zu letzteren gehörte ein "multi-rassischer" und ökumenisch toleranter islamischer Modernismus, mit dem die sansibarischen Intellektuellen den Anspruch des Westens in Frage stellten, die einzige universelle Zivilisation zu sein. Einmal in den Dienst der nationalistischen Mobilisierung gestellt, wurde jedoch auch der liberale Diskurs in eine Rhetorik der "rassischen Entmenschlichung" transformiert. "Arabische" Eliten blickten auf die "afrikanische" Bevölkerung der Insel, viele von ihnen Nachfahren von Sklaven, hinab. Vertreter der nationalistischen, stark von christlichen Kräften geprägten "African Association" schürten die Wut gegen die "arabischen Sklavenhalter".
Die wachsende Betonung von "Rassenunterschieden" in den politischen Auseinandersetzungen auf Sansibar war dabei vornehmlich das Resultat komplexer Debatten und Konflikte zwischen lokalen Intellektuellen, die der Autor detailliert nachzeichnet. Britische Kolonialbeamte und Missionare, westliche Denker und Konzepte weißer Suprematie spielten hingegen kaum eine Rolle. Glassman argumentiert an dieser Stelle nachdrücklich gegen das "Klischee des kolonialen Zusammenstoßes", gegen das in der Geschichtsschreibung zu Afrika immer noch verbreitete nationalistische Paradigma, welches alle Aspekte der neueren Historie des Kontinents im Kontext einer transzendenten Spannung zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten interpretiert.
Der Hinweis auf die Grenzen europäischer Indoktrination dürfe freilich, fügt er hinzu, nicht dazu verleiten, die "rassisch" konnotierten Konflikte auf Sansibar auf irgendwelche Atavismen und uralte "Stammesfehden" zurückzuführen. Der Rassediskurs war auch in Afrika ein moderner Diskurs, der stärker als lange gedacht von afrikanischen Intellektuellen mitgeprägt wurde.
Glassmans vorzügliche Studie zeigt quellennah und mit bewundernswerter Klarheit, wie sich Vorstellungen über Rasse und Nation in Gewalt, Terror und Trauma transformierten. Dieses Buch verdient daher eine breite Leserschaft, die über die Spezialisten der Geschichte Afrikas hinausgeht.
ANDREAS ECKERT
Jonathon Glassman: "War of Words, War of Stones". Racial Thought and Violence in Colonial Zanzibar.
Indiana University Press, Bloomington 2011. 410 S., br., Abb., 20,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main