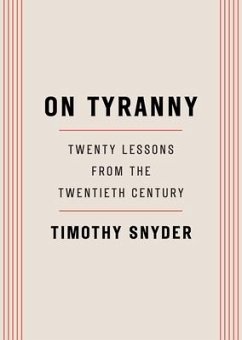Nicht lieferbar

Warum Demokratien Helden brauchen.
Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Die Demokratie steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Menschen sehnen sich seit jeher nach Lichtgestalten. Passt das heute noch in unser aufgeklärtes Weltbild? Ja, sagt Dieter Thomä. Er wendet sich gegen diejenigen, die sich in einer postheroischen Gesellschaft einrichten, und zeigt, wie leblos eine Demokratie ist, in der alle gleich sind. Thomä erklärt, warum heute Menschen gefragt sind, die über sich hinauswachsen und andere motivieren, es ihnen gleich zu tun. Die Demokratie tut gut daran, das Heldentum nicht denen zu überlassen, die autoritär oder fundamentalistisch denken....
Die Demokratie steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Menschen sehnen sich seit jeher nach Lichtgestalten. Passt das heute noch in unser aufgeklärtes Weltbild? Ja, sagt Dieter Thomä. Er wendet sich gegen diejenigen, die sich in einer postheroischen Gesellschaft einrichten, und zeigt, wie leblos eine Demokratie ist, in der alle gleich sind. Thomä erklärt, warum heute Menschen gefragt sind, die über sich hinauswachsen und andere motivieren, es ihnen gleich zu tun. Die Demokratie tut gut daran, das Heldentum nicht denen zu überlassen, die autoritär oder fundamentalistisch denken. Denn sie wird nicht nur von Institutionen zusammengehalten, sondern auch von Individuen, die sich für eine Sache einsetzen, die größer ist als sie selbst. Sie machen aus der Kampfeslust eine Tugend und wagen neue Wege. In der Suche nach den richtigen Helden - und im Streit um sie - schärft eine demokratische Gesellschaft ihr Profil. Gerade in Zeiten, in denen sie unter Druck steht, ist dies unverzichtbar.