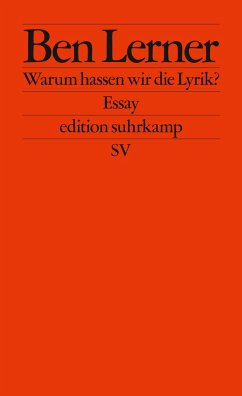Die Lyrik wird heftig denunziert wie keine andere Kunstform sonst. Sogar die Dichter:innen selbst scheinen sie zu missbilligen »Darin, dass sie Lyrik hassen, sind sich viel mehr Menschen einig, als sich darüber einigen können, was Lyrik überhaupt ist.«, schreibt Ben Lerner. »Ich mag sie auch nicht, habe aber mein Leben weitgehend um sie herum organisiert und empfinde das nicht als Widerspruch, weil Gedichte und der Hass auf die Lyrik für mich unentwirrbar miteinander verknüpft sind.« Auf welche Weise sie miteinander verknüpft sind, das wird hier in einem straffen Panorama skizziert.
Ben Lerner nimmt die Argumente der größten Lyrikfeinde in Augenschein, er lässt die besten und die schlechtesten Dichter:innen zu Wort kommen und erschließt uns beiläufig neuartige Perspektiven auf die Werke von Keats, Dickinson, McGonagall, Whitman und etlichen anderen. Und dabei versucht er, den grundsätzlich ehrenwerten Anspruch im Kern eines jeden Gedichts zu veranschaulichen - an dem die wahrhaft guten und die sagenhaft schlechten letztlich gleichermaßen scheitern.
Hassen wir die Lyrik, weil wir sie nicht verstehen? Oder hassen wir die Lyrik, weil sie Lyrik ist? Ben Lerner hat die originelle, aufschluss- und voltenreiche Verteidigung einer Gattung geschrieben, die seit 2500 Jahren inkriminiert wird.
Ben Lerner nimmt die Argumente der größten Lyrikfeinde in Augenschein, er lässt die besten und die schlechtesten Dichter:innen zu Wort kommen und erschließt uns beiläufig neuartige Perspektiven auf die Werke von Keats, Dickinson, McGonagall, Whitman und etlichen anderen. Und dabei versucht er, den grundsätzlich ehrenwerten Anspruch im Kern eines jeden Gedichts zu veranschaulichen - an dem die wahrhaft guten und die sagenhaft schlechten letztlich gleichermaßen scheitern.
Hassen wir die Lyrik, weil wir sie nicht verstehen? Oder hassen wir die Lyrik, weil sie Lyrik ist? Ben Lerner hat die originelle, aufschluss- und voltenreiche Verteidigung einer Gattung geschrieben, die seit 2500 Jahren inkriminiert wird.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Insa Wilke ist begeistert, dass der Suhrkamp-Verlag nach Ben Lerners erfolgreichem Roman "Die Topeka-Schule" nun auch seine Gedichte herausgibt. Und nicht nur das: Auch ein Essay, in dem Lerner über Lyrik reflektiert, liegt vor, freut sich die Kritikerin. Und so taucht Wilke zunächst ab ins poetische Werk des Amerikaners, übersetzt von Steffen Popp, zum Teil unter Mitarbeit von Monika Rinck - und erkennt die Strukturen der Gedichte, die sich um physikalische Phänomene, Politik und Poetologie drehen. Immer wieder begegnet die Rezensentin Referenzfeuerwerken in den zwischen Fachbegriffen und Alltagssprache changierenden Gedichten, in den nach der Zerstörung ganz neue Bilder zünden. Darüber hinaus sind es aber vor allem die leisen Momente, die die Kritikerin berühren. Zum besseren Verständnis von Lerners Poetologie empfiehlt Wilke dessen Essay "Warum hassen wir die Lyrik?"
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Lerners Gedichte sind genial ...« Anne-Sophie Balzer Berliner Zeitung 20210620