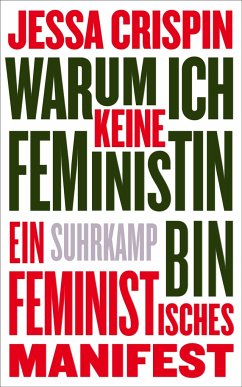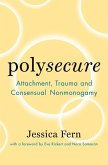In ihrem radikalen, geistreichen und dringlichen Manifest rechnet die amerikanische Aktivistin und Kulturkritikerin Jessa Crispin mit dem Feminismus ab. Am Ende ihres Essays steht nichts weniger als der Aufruf zum Umsturz der Gesellschaft.
Keine Feministin zu sein - für die amerikanische »Feministin« Jessa Crispin der einzige Ausweg. Während sich in den USA Hundertausende Pussyhats anziehen und demonstrierend durch die Straßen laufen, Popstars zu feministischen Ikonen gekürt werden und »Self-empowerment« à la Sheryl Sandberg zur neuen Religion des Lifestyle-Feminismus wird, erklärt Crispin den Feminismus für tot. Banal, anbiedernd und lächerlich findet sie den »Kampf« um die Freiheit der Frau. Was also tun? Crispin fordert nichts weniger als eine Revolution.
Keine Feministin zu sein - für die amerikanische »Feministin« Jessa Crispin der einzige Ausweg. Während sich in den USA Hundertausende Pussyhats anziehen und demonstrierend durch die Straßen laufen, Popstars zu feministischen Ikonen gekürt werden und »Self-empowerment« à la Sheryl Sandberg zur neuen Religion des Lifestyle-Feminismus wird, erklärt Crispin den Feminismus für tot. Banal, anbiedernd und lächerlich findet sie den »Kampf« um die Freiheit der Frau. Was also tun? Crispin fordert nichts weniger als eine Revolution.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Mag sein, dass Jessa Crispins Manifest ein wenig unausgegoren ist, räumt Catherine Newmark ein, auch erscheint es der Rezensentin an manchen Stellen naiv oder widersprüchlich. Dennoch findet sie die Intervention der amerikanischen Autorin richtig und wichtig. Crispin argumentiere nicht gegen einen Feminismus, der es zu weit getrieben habe, sondern im Gegenteil gegen einen, der sich zwar in den Medien größtmögliche Aufmerksamkeit sichert, in der Sache aber ziemlich ungefährlich sei, wenn nicht gleich ziemlich schnöde: Privilegierte Frauen versuchen, in Arbeitsleben und Politik die letzten noch nicht erklommenen Bastionen der Macht zu erstürmen. Crispin wünscht sich den Feminismus dagegen kritischer gegenüber jeglichen Machtverhältnissen. Auch schreibt sie recht bissig gegen weibliche Selbstviktimisierung und pauschale Abwertung von Männern. Das findet die Rezensentin ebenfalls sympathisch und bedenkenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Crispins Suada hat nicht nur verbalen Schmackes, sondern auch intellektuellen Charme. Es macht Spaß, ihr dabei zu folgen, wie sie vermeintliche Gewissheiten des Dritte-Welle-Feminismus zerlegt.« Nina Apin taz. die tageszeitung 20181009