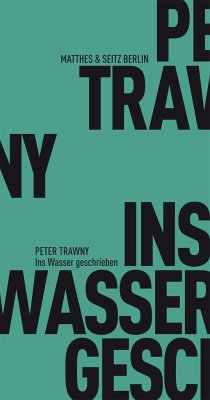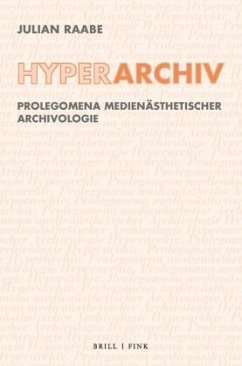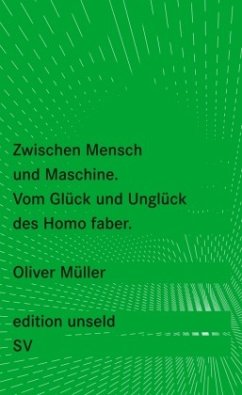Warum ist nicht alles schon verschwunden?

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Warum ist nicht alles schon verschwunden« ist der letzte Text Jean Baudrillards, der am 6. März 2007 verstarb. Darin unterzieht er nicht nur seine Theorie einer Revision, sondern entwirft ebenso eine neue Bildtheorie wie die Möglichkeit einer kritischen Sicht auf die Digitalisierung des Denkens.In einer überraschenden Denkbewegung führt Baudrillard in diesem dichten aber luziden Text den Leser von den Modi des Verschwindens bei Mensch und Maschine über den Nachweis des geheimen Fortlebens scheinbar verschwundener Ideologien, Werte und Verbote hin zur Unmöglichkeit der Repräsentation ...
»Warum ist nicht alles schon verschwunden« ist der letzte Text Jean Baudrillards, der am 6. März 2007 verstarb. Darin unterzieht er nicht nur seine Theorie einer Revision, sondern entwirft ebenso eine neue Bildtheorie wie die Möglichkeit einer kritischen Sicht auf die Digitalisierung des Denkens.In einer überraschenden Denkbewegung führt Baudrillard in diesem dichten aber luziden Text den Leser von den Modi des Verschwindens bei Mensch und Maschine über den Nachweis des geheimen Fortlebens scheinbar verschwundener Ideologien, Werte und Verbote hin zur Unmöglichkeit der Repräsentation von Realität im Digitalen.Sein Traum »von einem Bild, das die écriture automatique der Singularität der Welt wäre«, ist nicht zu verwirklichen in einer Welt, die in allen Bereichen sich selbst überflüssig macht. Baudrillard stellt zuletzt die Frage, woher dann trotzdem die Zerbrechlichkeit und die Verwundbarkeit durch scheinbar bedeutungslose Ereignisse kommt, und zeigt damit den Weg zu einer Kritik der Gegenwart auf, die sich nicht damit begnügt, Antworten zu geben.