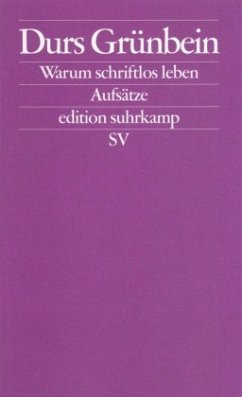In den neun Aufsätzen bzw. Reden dieses Bandes umkreist Durs Grünbein Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen des Schreibens.
"Im Schreiben versucht sich das Intime zu behaupten", heißt es etwa, "paradoxerweise, indem es sich öffentlich exponiert. Doch Öffentlichkeit ist, wie sich bald zeigt, nur eine besonders undurchlässige Schutzschicht." Grünbein läßt den Leser teilhaben an seinen Denkbewegungen, die Widersprüche nicht verkürzt in eine gewünschte Richtung manipulieren, sondern im Gegenteil entfalten. Wenn er Literatur oder genauer: Dichtung als "Gebilde aus Worten" in Beziehung setzt zum Tun der Architekten und Stadtplaner, wenn er den "Zusammenstoß von Wort und Musik" untersucht und den Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Kunstgattungen nachspürt, eröffnet er überraschende und erhellende Sichtweisen nicht nur auf die eigene Arbeit.
"Im Schreiben versucht sich das Intime zu behaupten", heißt es etwa, "paradoxerweise, indem es sich öffentlich exponiert. Doch Öffentlichkeit ist, wie sich bald zeigt, nur eine besonders undurchlässige Schutzschicht." Grünbein läßt den Leser teilhaben an seinen Denkbewegungen, die Widersprüche nicht verkürzt in eine gewünschte Richtung manipulieren, sondern im Gegenteil entfalten. Wenn er Literatur oder genauer: Dichtung als "Gebilde aus Worten" in Beziehung setzt zum Tun der Architekten und Stadtplaner, wenn er den "Zusammenstoß von Wort und Musik" untersucht und den Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Kunstgattungen nachspürt, eröffnet er überraschende und erhellende Sichtweisen nicht nur auf die eigene Arbeit.

Lieder, die die Welt braucht: Durs Grünbein macht sich Gesellschaft
Drei Fragen hat ein als schwierig empfundener Lyriker nach dem Vortrag seiner Gebilde zu gewärtigen: Kann man denn davon leben? Seit wann schreibt er dergleichen? Warum schreibt er so etwas? Manch einer empfindet diese Fragen als Zumutung einer Erwerbsgesellschaft, die das "Auftrittsrecht" der Literatur in Frage stellt, den Sinn des allgemeinen Betriebs aber nicht. Auch Durs Grünbein würde die Frager gern einmal mit der Gegenfrage erschrecken: ob sie denn wüßten, daß aus Leuten, die keine Künstler werden, nichts wird.
Aber Grünbein weiß, daß Dichtung schon immer darauf angewiesen war, "daß die Gesellschaft in ihrer Arbeitsteilung gut eingespielt war und ihre Festsänger mitfinanzierte". Dem entspricht seine gegen eine geschichtliche Tendenz von Platon bis zu den Diktaturen des zwanzigsten Jahrhunderts aufrechterhaltene Hoffnung, daß keine Gesellschaft, die noch irgend an ihre Bestimmung glaubt, es sich leisten könnte, "schwierige Dichtung als solche in Frage zu stellen".
Im übrigen stellt sich der Dichter die Fragen immer wieder auch selbst. Aber gerade vor ihm, der weiß, daß er sich "nur flüchtig kennt", weichen je die Antworten zurück. "Hinter jedem Ursprung steckt ein früherer Ursprung." Einen Moment in seinem Leben aber hebt Durs Grünbein mit der "Peinlichkeit einer Urszene" heraus: "Ein Soldat der Volksarmee, Funker bei den Motorisierten Schützen laut Dienstbuch, kehrt nach dem Grundwehrdienst zum ersten mal auf Urlaub in seine Geburtsstadt zurück. Er ist etwa achtzehn Jahre alt. Sein schmächtiger Körper steckt in einer Uniform, die ihn in seinen eigenen Augen zu einem Unberührbaren macht. Nach den Gesetzen seines paranoiden Staates ist er als vereidigter Rekrut zu einer Nummer im Wehrpaß geworden, in seiner Wirklichkeit jedoch, und nur diese zählt, zu einer Geisel im Kriegsfall ... In diesem Moment, den ich niemals vergessen werde, war in meinem noch frischen Leben das Stadium absoluter Hörigkeit erreicht."
Ein solches Erlebnis der Beschlagnahmung der Person kann Einsichten zeitigen, die "zur Grundausstattung des Dichters" gehören: "Erstens: Jeder stirbt für sich allein. Zweitens: Die Welt kommt ganz gut auch ohne dich aus. Und drittens: Da, wo man selbst ist, kann kein anderer sein." Die dritte Einsicht ist nicht nur für sich tröstlich, von ihr aus läßt auch "alles andere sich aushebeln". Da verwandelt sich die Erfahrung der Trennung und Isolation ins Glück des Entrinnens und der Subversion.
Gedichte sind in diesem Zusammenhang "Botschaften aus langjähriger Einzelhaft", Kassiber, die "wie durch ein Wunder aus der universellen Zwangsanstalt herausgeschmuggelt" werden. Dem Schreiben wie dem Lesen von Gedichten haftet so "etwas Unerlaubtes an", wie es allemal die reizt, die "geistige Abwechslung" suchen. Denn ohne Kunst wäre die Welt "ein Ort der Plackerei und Langweile". Dagegen "glitzert und funkelt" das Gedicht, obwohl es aus den "allergewöhnlichsten Silben" besteht.
Ein Gedicht also ist nach wie vor Flaschenpost, die "ein ansprechbares Du" finden soll, unberechenbar in ihrem Kurs, oder Taschenspiegel, der über Entfernungen hinweg blendet; Zufall, wen das Licht erreicht und fragen läßt. In seinen Aufsätzen stellt Grünbein potentiellen Lesern vorsorglich Gegenfragen. Der Titel ist eine davon, aber ohne Fragezeichen. Es gibt keinen Grund, Gedichte nicht zu lesen, mag die Welt sie brauchen oder nicht.
Mit seinen Fragen macht sich Grünbein Gesellschaft. Er betrachtet das "Panoramagemälde" der Weltliteratur mit Goethes Augen, zwischen "Antike und X" zitiert er Geister herbei und merkt auf Zurufe. Er belebt den "verschwundenen Platz" mit Gestalten; auf seiner Agora wird philosophischen "Oligarchen, die Staat und Gesellschaft für sich beanspruchen", mit Adorno die Stilfrage gestellt. Als "Komplize der Vergänglichkeit" bittet dagegen der "Silbenschmied" alle anderen zur "Pause im Sterben", zum Tanz auf unüberwachtem Platz. Warum der Einladung nicht folgen.
FRIEDMAR APEL
Durs Grünbein: "Warum schriftlos leben". Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 122 S., br., 8,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Mit Gewinn scheint Rezensent Friedmar Apel diese Aufsätze von Durs Grünbein gelesen zu haben, die sich, wie man seinen Ausführungen entnehmen kann, mit Fragen von Dichtung und Gesellschaft befassen: zum Beispiel mit der Erkenntnis, dass "die Gesellschaft in ihrer Arbeitsteilung gut eingespielt war und ihre Festsänger mitfinanzierte", oder mit der Hoffnung, "dass keine Gesellschaft, die noch an sich selber glaubt", schwierige Dichtung als solche in Frage stellen wird. Auch Grünbeins Ausführungen über das Dichten selbst sind beim Rezensenten nicht ohne Eindruck geblieben. So scheint ihn Grünbeins Ansicht, dass die Welt ohne Kunst "ein Ort der Plackerei und Langeweile" sei, ziemlich überzeugt zu haben und bei der Betrachtung des Panoramagemäldes Weltliteratur hat Apel dem Dichter offensichtlich auch gern über die Schulter geschaut.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"