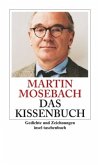Moderner Jahrmarkt der Eitelkeiten
Im breitgefächerten Œuvre des mit dem Büchnerpreis ausgezeichneten Schriftstellers Martin Mosebach wird bei den Romanen häufig das Scheitern thematisiert, so auch in «Was davor geschah». Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung nannte den Autor 2007 in
ihrer Laudatio nicht nur einen «genialen Formspieler», er verbinde zudem «stilistische Pracht mit…mehrModerner Jahrmarkt der Eitelkeiten
Im breitgefächerten Œuvre des mit dem Büchnerpreis ausgezeichneten Schriftstellers Martin Mosebach wird bei den Romanen häufig das Scheitern thematisiert, so auch in «Was davor geschah». Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung nannte den Autor 2007 in ihrer Laudatio nicht nur einen «genialen Formspieler», er verbinde zudem «stilistische Pracht mit urwüchsiger Erzählfreude». Ein derart überschwängliches Lob löst in der Fachwelt regelmäßig erbitterte, vom Neid befeuerte Debatten aus, von «affektierten Vokabeln» und «verzopften Phrasen aus der bürgerlichen Mottenkiste» konnte man da lesen. Nach der Lektüre des vorliegenden Romans wird man diesem Verdikt vehement widersprechen, vielleicht auch gerade deshalb, weil der Autor gottlob mit seinen intellektuell hochstehenden Romanen unbeirrt nichts bestsellertauglich Profanes abliefert!
Es gibt wohl kaum eine explosivere Frage in einer aufkeimenden Liebesbeziehung als die nach der Zeit davor, nach dem also, «was davor geschah». Dieser drängenden Frage seiner Liebsten kommt der namenlose Ich-Erzähler, ein 35jähriger Bankkaufmann, der vor sechs Monaten nach Frankfurt gezogen ist, gerne nach, seine Erlebnisse in der Stadt am Main bilden letztendlich den alleinigen Erzählstoff dieses Gesellschaftsromans. Er lernt gleich zu Beginn den Sohn der ebenso kultivierten wie wohlhabenden Familie Hopsten kennen, der ihn zur nächsten der allsonntäglich in ihrer pompösen Villa stattfindenden Party einlädt. Prompt verliebt er sich hoffungslos in die schöne Phoebe, die Schwester seines Freundes. Er lernt zudem einen illustren Kreis von Stammgästen kennen, die zusammen mit dem prominenten Ehepaar Bernward und Rosemarie Hopsten das Figuren-Ensemble dieses Romans bilden. Dazu zählen insbesondere der zuverlässig jede Konversation in Gang haltende Schwadroneur und hochrangige Ex-Politiker Schmidt-Flex mit Frau sowie dessen dröger Sohn und seine attraktive, weinselige Frau Silvi. Diesen inneren Kern der Partygesellschaft ergänzen Helga, Freundin und Beraterin der Hausherrin in stilistischen und ästhetischen Fragen, sowie der ebenso zwielichtige wie charismatische Geschäftsmann und Schürzenjäger Joseph Salam.
Genüsslich erzählend breitet Martin Mosebach das vielfach verknüpfte Beziehungsgeflecht dieser Figuren in einer geradezu süffigen Sprache vor dem Leser aus. Von der ersten Seite an erinnert er damit stilistisch an Thomas Mann oder Lew Tolstoi, nur dass sein Sittenbild einer bourgeoisen Gesellschaft sich auf einen deutlich kleineren, überschaubaren Kreis von Figuren stützt – und mit wesentlich weniger Seiten auskommt! Es gehört zur narrativen Kunst des Autors, dass er dem Leser seine lebensechten Protagonisten menschlich derart nahe zu bringen vermag, dass man jeden von ihnen zu kennen glaubt in seiner realistisch erscheinenden Charakterzeichnung, - und niemand von ihnen wirkt unsympathisch oder gar abstoßend. Was den Leser da so sinnlich mitreißt in diesem Vexierbild einer gehobenen Gesellschaft unserer Tage, das ist vor allem ein kontemplatives Vergnügen, bei dem scheinbar bedeutungslose Szenen wie eine nächtliche Schlittenfahrt der ganzen Partytruppe im Taunus oder die akribische Federputz-Prozedur eines weißen Kakadus äußerst subtil und anschaulich geschildert werden.
Derart wortmächtig und elegant schreibt niemand anderes in der gegenwärtigen deutschen Literatur. In seinem - bis auf die Rahmenhandlung - klug konstruierten Plot entlarvt der Autor moralisch streng, aber auch unverkennbar ironisch den Aberwitz in seinem ‹Jahrmarkt der Eitelkeiten› moderner Prägung mit seinen amourösen Verstrickungen. Der scheherazadeartige Handlungsrahmen allerdings mit seinen gelegentlich eingestreuten, typografisch abgesetzten, kurzen und irrealen Dialogen ist wenig überzeugend, und auch der unbestimmt zwischen personaler und auktorialer Warte changierende, konturlose Ich-Erzähler ist literarisch ein kleiner Wermutstropfen in dieser ansonsten makellosen Erzählung.