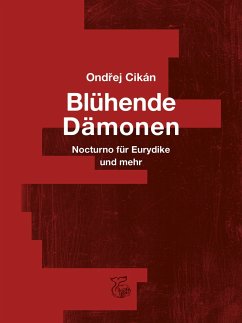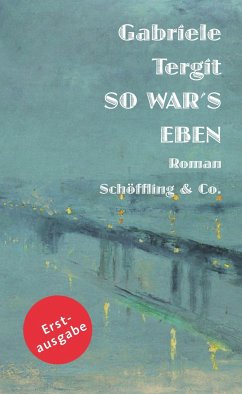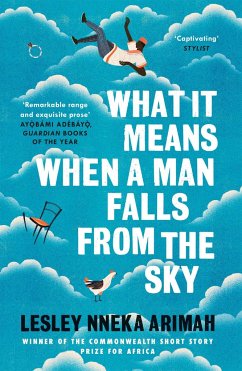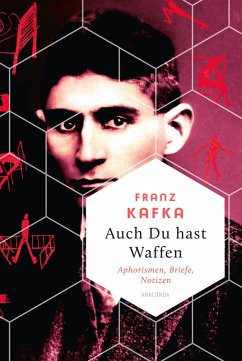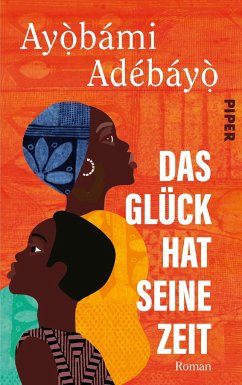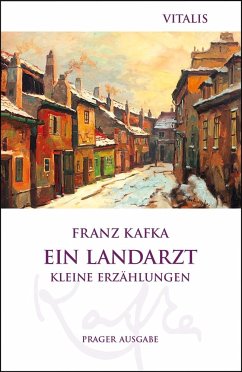Was du nicht hast, das brauchst du nicht

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ausgezeichnet mit dem PEN Open Book Award»Überragend.« The New York Times Book ReviewDas neue Buch der preisgekrönten StarautorinWilde, bunte Geschichten für wilde, bunte Zeiten»Oyeyemi bremst für niemanden.« Vulture»Helen Oyeyemi ist eine der aufregendsten, geistreichsten und neugierigsten Schriftstellerinnen unserer Zeit - und eine Autorin von Sätzen, die so elegant sind, dass sie leuchten.« The TimesAlles beginnt mit einem ausgesetzten Baby, das einen goldenen Schlüssel zu einem verwunschenen Garten um den Hals trägt ...Helen Oyeyemi trägt uns mit ihrer unvergleichlichen Fanta...
Ausgezeichnet mit dem PEN Open Book Award»Überragend.« The New York Times Book ReviewDas neue Buch der preisgekrönten StarautorinWilde, bunte Geschichten für wilde, bunte Zeiten»Oyeyemi bremst für niemanden.« Vulture»Helen Oyeyemi ist eine der aufregendsten, geistreichsten und neugierigsten Schriftstellerinnen unserer Zeit - und eine Autorin von Sätzen, die so elegant sind, dass sie leuchten.« The TimesAlles beginnt mit einem ausgesetzten Baby, das einen goldenen Schlüssel zu einem verwunschenen Garten um den Hals trägt ...Helen Oyeyemi trägt uns mit ihrer unvergleichlichen Fantasie durch Zeiten und Länder, verwischt die Grenzen gleichzeitig existierender Wirklichkeiten, verbindet dabei leichtfüßig den Erzählreigen durch immer wiederkehrende Figuren, Schauplätze und vor allem - Schlüssel. Schlüssel zu Orten, Herzen und Geheimnissen. Und immer wieder stellt sich die Frage, ob ein Schlüssel wirklich gedreht werden soll, oder ob es besser ist, dem Unbekannten seine Magie zu lassen.Helen Oyeyemis immer überraschende Geschichten nähren sich aus Märchen und Mythen und wendet sie zu einem geistreichen Kommentar einer sehr aktuellen Gegenwart.Wilde, bunte Geschichten für wilde, bunte Zeiten.»Jede Zeile leuchtet; jedes Bild ist so präzise, stimmig und so genau platziert, als wäre es aus Glas geschnitten. Eine wirklich ausgesprochen schöne Geschichtensammlung, voller Ideen und Bilder, die noch für eine sehr lange Zeit in den Gedanken nachklingen.« Vox»Je länger man sich von dem erzählerischen Garn dieser Geschichten einspinnen lässt, umso mehr Geheimnisse und Gefahren begegnen einem, und mit jeder Erzählung hatte ich die wunderbare und seltene Erfahrung, vollkommen überrascht zu werden ... überragend.« The New York Times Book Review»Eine ausgesprochen süchtig machende Lektüre.« Nylon»Helen Oyeyemi ist ein literarisches Genie.« Bustle»Helen Oyeyemi hat sich als eine der erstklassigsten Geschichtenerzählerinnen in der zeitgenössischen Literatur etabliert.« Flavorwire»Eine Offenbarung ... der perfekte Prosaband.« Mashable»Oyeyemi hat ein Auge für das leicht Verschrobene, das seltsame Detail, das die Normalität in etwas Wunderbares und erschreckend Seltsames verwandelt.« The Boston Globe»Oyeyemi bringt Magie in das Leben ihrer zeitgemäßen, heutigen Figuren.« TIME»Das Buch ist, in einem Wort, makellos ... 'Was Du nicht hast, das brauchst Du nicht' ist so Vieles zugleich: verträumt, fesselnd und vollkommen anders als alles, was man sich vorstellen könnte. Oyeyemis Talent ist ebenso einzigartig wie beeindruckend.« NPR (National Public Radio)»Wunderbar originell ... Die einfallsreichste Geschichtensammlung des Jahres.« O, The Oprah Magazine»Freigeistig und erfinderisch ... Diese Geschichten sind voller Zärtlichkeit, Humor und seltsamer Freuden.« The Financial Times»Zauberhaft und atemberaubend.» Elle