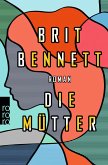Niemals aufgeben: ein Buch voller zweiter Chancen
Alleinerziehende Mütter, Alkoholikerinnen auf Entzug, Haushaltshilfen, Krankenschwestern und Sekretärinnen - Lucia Berlin erzählt von unterprivilegierten Frauen, die um ein besseres Leben kämpfen. In Waschsalons, Cafés und Restaurants, Krankenhäusern und Arztpraxen zeigen sich die kleinen Wunder des Lebens oder entwickeln sich herzzerreißende Tragödien, denen die Autorin mal mit abgründigem Humor, dann wieder voller Melancholie, aber stets mit ergreifender Empathie auf den Grund geht.
Unsentimental und unaufgeregt erkundet Lucia Berlin die Warteräume des Lebens und richtet ihren Blick nicht nur auf die schmutzigen Winkel, sondern auch auf die Sonnenstrahlen mitten im prosaischen Alltag.
Alleinerziehende Mütter, Alkoholikerinnen auf Entzug, Haushaltshilfen, Krankenschwestern und Sekretärinnen - Lucia Berlin erzählt von unterprivilegierten Frauen, die um ein besseres Leben kämpfen. In Waschsalons, Cafés und Restaurants, Krankenhäusern und Arztpraxen zeigen sich die kleinen Wunder des Lebens oder entwickeln sich herzzerreißende Tragödien, denen die Autorin mal mit abgründigem Humor, dann wieder voller Melancholie, aber stets mit ergreifender Empathie auf den Grund geht.
Unsentimental und unaufgeregt erkundet Lucia Berlin die Warteräume des Lebens und richtet ihren Blick nicht nur auf die schmutzigen Winkel, sondern auch auf die Sonnenstrahlen mitten im prosaischen Alltag.
Lucia Berlin erzählt in 'Was ich sonst noch verpasst habe' von bewegenden Frauen-Schicksalen. Freundin 20171018
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Christopher Schmidt hat viel übrig für Lucia Berlin, die schmutzige Schwester von Doris Day, wie er schreibt, und für ihre autofiktionalen, grausam pointierten und verdichteten Geschichten aus der Hölle des alkohol- und drogenkranken Prekariats, der Erniedrigten und Beleidigten, die sich an Flaubert und Tschechow anlehnen und an John Williams. "Präzise Feuerstöße aus dem Pandämonium der Deklassierten", lobt er. Die von Antje Ravic Strubel besorgte Auswahl einer Auswahl ihrer Storys bedenkt der Rezensent daher mit besonderer Aufmerksamkeit - und einer Kritik an der Einordnung der Autorin durch die Herausgeberin als "urwüchsig". Auch die chronologische Anordnung der Texte erscheint Schmidt irreführend, da sie eine vermeintliche Naturhaftigkeit von Berlins Schreibens konstruiert, die es nicht gibt, wie er findet. Die Herausgeberin als Kurator der Texte ist ein Konzept, das laut Rezensent nicht immer aufgeht. An Ravic Strubels Übersetzung hat Schmidt aber nur wenig auszusetzen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Zu Lebzeiten war die amerikanische Autorin Lucia Berlin nahezu unbekannt. Jetzt ist sie mit ihren aufregenden Stories "Was ich sonst noch verpasst habe" auf Deutsch zu entdecken.
Ruhelos war das Leben der amerikanischen Autorin Lucia Berlin von Beginn an. 1936 als Tochter eines Bergbauingenieurs geboren, zog die Familie den Arbeitsstätten des Vaters hinterher, in die Minenfelder Alaskas und den Mittleren Westen, nach Idaho, Kentucky und El Paso. Die Rastlosigkeit legte sie auch als Erwachsene nicht ab und ebenso wenig den prekären Status. Denn auch wenn zwischenzeitlich Geld vorhanden war, folgten die Abstürze verlässlich. Dann schlug sich Lucia Berlin mit schlechtbezahlten Jobs als Telefonistin, Putzfrau oder Hilfslehrerin durch. Als sie zweiunddreißig war, hatte sie bereits dreimal geheiratet und vier Söhne, die sie allein aufzog. Und außerdem ein handfestes Alkoholproblem.
Dieses aufreibende Leben ist der Stoff, aus dem Lucia Berlin ihre Geschichten destilliert. Lange vor der neuerlichen Begeisterung für die Autofiktionen von Schriftstellern wie Karl-Ove Knausgård oder Tomas Espedal mischte sie, die zu Lebzeiten nur wenigen Insidern bekannt war, Erfundenes mit autobiographischem Material. Man muss ihre Lebensgeschichte nicht kennen, um sich diese Prosa zu schätzen. Aber es belegt, was Hemingway einst gesagt haben soll: dass man gelebt haben muss, um schreiben zu können.
Lucia Berlin konnte schreiben, und wie. Ihre Stories sind atemberaubend, intensiv, gegenwärtig und voller verblüffender Wendungen. Auf drei Seiten bündeln sie den ganzen Schmerz einer Existenz und sind dabei zugleich von einem unbändigen Hunger auf das Leben getrieben. Zwölf Jahre nach ihrem Tod ist Lucia Berlin nun auch auf Deutsch zu entdecken: "Was ich sonst noch verpasst habe" heißt der Band, der dreißig ihrer Stories versammelt. Die Übersetzerin Antje Rávic Strubel hat für dieses quer durch alle Klassen und Slangs mäandernde Amerikanisch überzeugende Entsprechungen gefunden.
Wovon Lucia Berlin erzählt, kennt sie genau. Es sind die düsteren Seiten des amerikanischen Borderline-Lebens, Geschichten vom Umherwandern, Alkoholmissbrauch und dysfunktionalen Beziehungen. Sie beobachtet und schreibt, ohne sich an den Krisen zu weiden. "Ich mag Diane Arbus nicht", heißt es über die Fotografin mit den schonungslosen Porträts amerikanischer Randfiguren in einer Geschichte. "Als ich Kind war, gab es in Texas Freak-Shows, und schon damals hasste ich die Leute, die mit Fingern auf die Missgebildeten zeigten und über sie lachten. Aber ich war auch fasziniert." Die Autorin, die als Kind an Sklerose erkrankte und ein eisernes Korsett tragen musste, war selbst oft genug Opfer von Hänseleien. Und Einsamkeit ist eine Konstante ihrer Geschichten, und doch schimmert ein rettender Witz immer durch.
Dann wieder wird es urplötzlich brutal. Da werden in einem Satz alle vorherigen Gewissheiten über Bord geworfen. "Stille" erzählt von dem Mädchen, das vor der Langeweile von El Paso zu ihrem Onkel flieht. Er ist der Einzige, der sich um das vernachlässigte Kind kümmert. Er macht ihr Puffweizen mit Milch, während er Bourbon trinkt. Und manchmal nimmt er sie mit in seinem Lastwagen. Bei einer dieser Touren fährt er einen Jungen und dessen Hund an. "Halt an", kreischt das Mädchen, doch der Onkel fährt weiter. Erst Jahre später, lautet der letzte Satz, weiß sie, warum: "Denn mittlerweile war ich selbst eine Alkoholikerin."
In einer anderen Geschichte plagt sich eine junge Frau auf dem Weg zu einem Familienfest mit der Frage, ob sie abtreiben soll oder nicht. Sie denkt, schlimmer könne es nicht kommen, bis sie erfährt, dass sich ihre Mutter soeben die Pulsadern aufgeschnitten hat: "Na ja, nicht schlimm", sagt man ihr: "Sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben, in dem steht, dass du ihr Leben ruiniert hast. Unterschrieben mit Bloody Mary!". Es ist diese seltsame Mischung aus Erbarmungslosigkeit und eruptivem Witz, die sich durch diese Prosa zieht. "Ich arbeite gern in der Notaufnahme - jedenfalls lernt man dort Männer kennen", kann so eine Geschichte beginnen. An den Röntgenaufnahmen von Jockeys hat die Erzählerin die meiste Freude: Sie brechen sich so häufig die Knochen, "ihre Skelette sehen aus wie Bäume".
Die meist weiblichen Protagonisten entstammen der Arbeitswelt, sie sind Krankenschwestern, Putzfrauen oder Hilfslehrerinnen. Sie verdienen wenig und finden kaum Beachtung, dafür haben sie ihre eigenen Weisheiten: "Je schwerer die Krankheit der Patienten ist, umso weniger Lärm machen sie", weiß eine Krankenhausmitarbeiterin in "Temps Perdu". Deshalb überhört sie Rufe der Patienten durch die Sprechanlage. Gleichgültigkeit ist ihre Waffe gegen das Leiden. "Bekämpfe es, merze es aus. Ignoriere es, wenn es sein muss", meint sie, aber ermutige niemals Patienten, ihr Kranksein zu mögen. Und dann kommt der Stationsschwester beim Anblick des Kolostomiebeutels am Bett eines Patienten plötzlich ein hinreißender Gedanke: "Was, wenn unsere Körper durchsichtig wären, ausgestattet mit einem Fenster wie Waschmaschinen?" Dann könnte man, räsoniert sie, sich selbst zuschauen, wie das Blut und die Körpersäfte durch den Organismus fließen.
Mit Transparenz hat auch die Literatur von Lucia Berlin etwas zu tun. Denn sie macht aus ihren Geschichten kein Geheimnis. Ihre Sprache ist direkt, durchdringend, und sie kommt ohne formale Spielereien aus. Trotzdem ist ihr Zugang zur Welt kein journalistischer, sondern die Texte, die mal eine halbe Seite lang sind oder mehrere Dutzend, sind eigenwillig und poetisch arrangiert. Sie beginnen ansatzlos und ohne den Kontext näher zu erläutern, bisweilen taumeln sie regelrecht durch die Zeit. Einfache Antworten, moralische Gewissheiten hat Lucia Berlin nicht zu bieten. Wer in "Mijito" über eine illegal in Oakland lebende Mexikanerin, deren Kind stirbt, am Ende die Schuld trägt, ist nicht ausgemacht. Alle sind hier überfordert, die Ärzte, die zu übermüdet sind, um die Anzeichen von Gewalt zu erkennen. Die Mutter, die in ihrer Gastfamilie selbst ein Missbrauchsopfer wird, nachdem ihr Mann ins Gefängnis kommt. Losgesagt von der Schuld wird niemand am Tod des kleinen Jesus.
Unter den vielen Leben, die Lucia Berlin führte, zieht sich ihre Alkoholsucht durch viele Stories. "Unbeherrschbar" erzählt auf fünf atemlosen Seiten von einer Mutter, die noch in der Nacht, ehe ihre Söhne aufwachen, versucht, an Alkohol zu kommen. Der Fußweg zum nächsten Laden dauert eine Dreiviertelstunde. "Sie wünschte sich, sie hätte einen Hund zum Gassiführen", um nicht aufzufallen. Sie schafft es, gerade so, aber die Kinder müssen trotzdem mit nassen Socken in die Schule gehen.
Die Geschichten stehen zwar für sich, aber es ist ratsam, sie nacheinander zu lesen, denn das Auftauchen bestimmter Personen und Orte folgt einer inneren Logik. Lucia Berlin, schrieb anlässlich eines frühen Bandes einmal ein amerikanischer Kritiker, sei eines "der bestgehüteten Geheimnisse Amerikas". Damit ist es nun endgültig vorbei.
SANDRA KEGEL
Lucia Berlin: "Was ich sonst noch verpasst habe". Stories.
Aus dem Amerikanischen von Antje Rávic Strubel. Arche Verlag, Hamburg 2016. 382 S. geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main