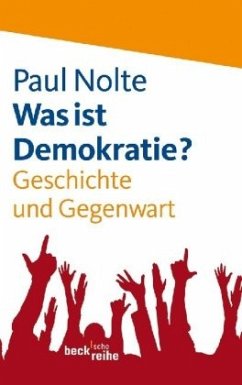Die Demokratie ist ins Gerede gekommen - die Wahlbeteiligung schwindet, die Skepsis der Bürger gegenüber den Politikern nimmt zu. Die Regierungen wirken machtlos im Kampf um die Regulierung der globalen Finanzmärkte. Zugleich ist in Nordafrika ein demokratischer Frühling erwacht, in den Millionen Menschen ihre Hoffnungen setzen, und in China rufen mutige Dissidenten wie Liu Xiaobo nach mehr Freiheit und Menschenrechten. Was aber meinen wir eigentlich, wenn wir von Demokratie sprechen? Warum gibt es ein Parlament, wie sind die Parteien entstanden? Brauchen wir mehr direkte Beteiligung des Volkes? Kommt die Demokratie in einer globalen und multikulturellen Welt an die Grenzen ihrer Möglichkeiten?
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine durchaus optimistische historische Bestandsaufnahme der Demokratie erblickt Andreas Rödder in Paul Noltes Buch über "Geschichte und Gegenwart" der Demokratie. Er attestiert dem Autor, eine Fülle von Themen und Fragen, die die Demokratie betreffen, anzugehen und dabei auch viele Fragen offen zu lassen. Rödder ist mit Noltes gelassenen historischen Einschätzungen, nach denen die Demokratie letztlich als eine Erfolgsgeschichte zu lesen ist, im Wesentlichen einverstanden, hätte sich im Detail aber oft einen etwas genaueren Blick, eine prägnantere Argumentation und präzisere Thesen gewünscht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Paul Nolte legte eine historische Bestandsaufnahme der multiplen Demokratie vor
Die Demokratie ist stark und schwach zugleich. Einerseits hat sie sich im Laufe der beiden vergangenen Jahrhunderte immer weiter verbreitet, andererseits ist ihr die Kritik gleichsam eingeboren. Und so wie im Deutschland der Zwischenkriegszeit die Effizienz der demokratischen Systeme gegenüber den totalitären Diktaturen bezweifelt wurde, so wird heute die Wettbewerbsfähigkeit der westlichen Demokratien gegenüber dem ebenso marktwirtschaftlichen wie nichtdemokratischen China in Frage gestellt. Hinzu kommen neue Phänomene wie die Occupy-Bewegung und die Piratenpartei, die "Wutbürger" oder auch die "Arabellion", und immer noch die europäischen Revolutionen von 1989. Als Fluchtpunkt der jüngeren Entwicklungen identifiziert Paul Noltes historische Bestandsaufnahme "eine vielfältige, eine multiple Demokratie". Dieser konzeptionelle Rahmen dient als eine Art Perlenschnur, auf der insgesamt 76 Aspekte aufgezogen werden, die das Thema in großen Bögen und mit vielfältigen Querverweisen umkreisen.
Im Rückblick auf die Antike erkennt Nolte in der athenischen Demokratie das Prinzip der Isonomie, der "Ordnung der (untereinander) Gleichen", und in der römischen Republik, die keine Demokratie war, das Rechtsprinzip. Anders als etwa Philippe Nemo oder Heinrich August Winkler erkennt er darin allerdings keine Begründung einer mehrtausendjährigen Tradition "des Westens". Vielmehr betont Nolte die fundamentalen Unterschiede, namentlich das Bewusstsein von der Gestaltbarkeit der Verhältnisse sowie die Wertschätzung des Individuums mit seinen Menschen- und Freiheitsrechten. Diese setzt er nicht vor der Aufklärung und der (nordwest)europäisch-nordamerikanischen Moderne seit dem späten 18. Jahrhundert an.
Hier lässt er die moderne Demokratie beginnen, wobei sich sogleich die Frage stellt, wie demokratisch die Französische Revolution war. Als Frankreich im September 1792 eine Demokratie im Sinne der Staatsform wurde, war die Revolution auf dem Weg der Radikalisierung in die Schreckensherrschaft. Elemente einer demokratischen Regierungsform besaß bereits die Verfassung der konstitutionellen Monarchie von 1791, wobei diese Begriffe ebenso wenig systematisch unterschieden werden wie Formen von Verfassungen und politischen Systemen. Stattdessen nimmt Nolte besonderen Bezug auf die Abschaffung der Feudalordnung am 4. August 1789, denn er versteht Demokratie nicht nur als Form der Herrschaft, sondern als Lebensform unter Einschluss sozialer Rechte und Teilhabe. Er geht somit von einem integralen Programm von sozialer Demokratie aus, das sich zugleich auf Kosten begrifflicher Präzision und argumentativer Prägnanz auswirkt.
Auch der Ansatz einer "zeitgemäßen Demokratiewissenschaft" aus Geschichte, empirischen Sozialwissenschaften und Sozialtheorie wird nur bedingt eingelöst. Vielmehr finden sich zentrale politikwissenschaftliche Positionen und Vertreter höchstens indirekt wieder - mit Ausnahme von Jürgen Habermas, der meistzitierten Person des Buches. Dies wie auch Noltes expliziter Rekurs auf das Konzept einer "Historischen Sozialwissenschaft" verankert das Buch auf seine Weise in einem spezifisch normativen Diskursstrang der "alten Bundesrepublik" - wobei Nolte selbst am besten weiß (und auch schreibt), dass die Geschichte eben nicht in dieser vermeintlich guten alten Zeit stehengeblieben ist, sondern gerade seit dem ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert neue Fragen und Probleme aufgeworfen hat.
So hat die europäische Einigung mit dem Vertrag von Maastricht 1992 einen Konstitutionalisierungsschub erlebt und immer weitere Kompetenzen hinzugewonnen, bis das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag im Jahr 2009 die Grenzen einer weiteren europäischen Integration aufgezeigt hat. Bezeichnenderweise hat Karlsruhe dies gerade am Demokratieprinzip festgemacht, und zwar nicht nur an formalen Organisationsprinzipien, sondern am diskursiven "Raum einer politischen Öffentlichkeit". Die abermalige Verstärkung des europäischen "Integrationssogs" gerade in der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise steht dazu (und zu den europäischen Verträgen) in einer fundamentalen Spannung. Dass Nolte demgegenüber darauf verweist, dass die europäische Integration vor allem die demokratischen Nationalstaaten gesichert habe, ist zwar in der Sache richtig, wird aber der Problemlage nicht gerecht.
Zugleich haben die Globalisierung und die Liberalisierung der Finanzmärkte neue Dimensionen finanzieller Risiken hervorgebracht, für die zuletzt - wegen der zu befürchtenden sozialen Verwerfungen ("too big to fail") - die Staaten in Haftung getreten sind. Autoren wie Wolfgang Streeck sehen darin eine "Krise des demokratischen Kapitalismus" zugunsten einer globalen Elite von Kapitaleignern und Finanzmarktakteuren. Nolte hält dem ebenso richtig wie doch etwas pauschal entgegen, dass es "keine moderne Demokratie ohne kapitalistische Marktwirtschaft" gebe (ohne die Notwendigkeit der staatlichen Regulierung der Wirtschaft zu vergessen).
Vor allem aber verweist er auf neue Entwicklungen der "Zivilgesellschaft": soziale und Protestbewegungen, gemeinwohlorientiertes bürgerschaftliches Engagement im Bereich von Menschenrechten, Umwelt und Verbraucherschutz, oft lose organisierte NGOs als Kontrollinstanzen repräsentativ-demokratischer Prozesse, deren Spannungen gegenüber etablierten staatlichen und demokratischen Institutionen er durchaus anspricht. Inwiefern die globale Zivilgesellschaft in einer "Welt jenseits der klassischen Staatsgrenzenordnung . . . sogar eine Führungsrolle für die Erweiterung und Transformation von Demokratie übernommen" hat, wird dabei letztlich allerdings ebenso (bewusst) offengelassen wie viele andere Fragen, etwa nach der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie.
Das Buch findet sich mithin selbst mitten in dem Prozess der jüngeren Demokratieentwicklung wieder, den Nolte als "Suchbewegung" charakterisiert, und so verzichtet es auch auf ein explizites Resümee. Die eigentliche These findet sich am Anfang: Letztlich handelt es sich doch um eine Erfolgsgeschichte, in der die "Dynamisierung demokratischer Erwartungshaltungen und Handlungsformen im Westen seit den 1970er Jahren" zu einem vielgestaltigen Formwandel von Demokratie geführt hat, der sich als turbulenter Prozess der "Neuerfindung, aber auch des Abschieds von der Eindeutigkeit des repräsentativ-elektoralen Modells der Nachkriegszeit" verstehen lässt. So komfortabel die optimistische Gelassenheit dieses weiten historischen Blicks in eine vielgestaltige Vergangenheit und eine offene Zukunft auch ist - etwas schärfer und pointierter hätte er zuweilen durchaus sein dürfen.
ANDREAS RÖDDER
Paul Nolte: Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. C. H. Beck Verlag, München 2012. 512 S., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main