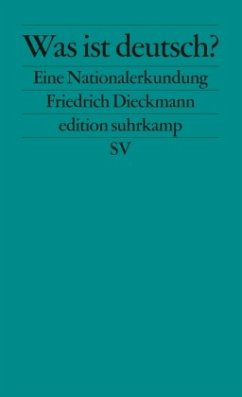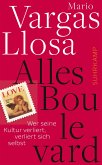Ein Leipziger Berufsschullehrer irritierte seine zum rechten Spektrum tendierenden Schüler mit dem Hinweis, sie sollten sich hüten, sich mit dem Wort deutsch zu brüsten, da sie ihre Muttersprache so schlecht beherrschten, als kämen sie aus Einwandererfamilien.
Das paßgenaue Gegenbild lieferte jener siebzehnjährige Intellektuellensproß aus links geprägtem Milieu, der auf die Frage seines Vaters, was deutsch sei, wie aus der Pistole geschossen antwortete: »Adolf Hitler.«
Was also ist deutsch - fragt Friedrich Dieckmann. Können Deutsche diese Frage beantworten? Besser, man fragt die vielberufenen Ausländer, die man fast schon Scheu hat, Ausländer zu nennen statt »ausländische Mitbürger«. Ist der Hang zu Sprachregelungen etwas spezifisch Deutsches? Ist es der Hang, allem Ausländischen nachzubeten, wenn es sich den Anschein des Siegreich-Zeitgemäßen zu geben weiß? Ist diese Unselbständigkeit des kulturellen Empfindens etwas eigentümlich Deutsches? Oder wäre, in dritter Stufe, der manische Hang zur Selbstkritik bis zur Selbstherabsetzung, ja zum Selbsthaß das spezifisch Deutsche?
Das paßgenaue Gegenbild lieferte jener siebzehnjährige Intellektuellensproß aus links geprägtem Milieu, der auf die Frage seines Vaters, was deutsch sei, wie aus der Pistole geschossen antwortete: »Adolf Hitler.«
Was also ist deutsch - fragt Friedrich Dieckmann. Können Deutsche diese Frage beantworten? Besser, man fragt die vielberufenen Ausländer, die man fast schon Scheu hat, Ausländer zu nennen statt »ausländische Mitbürger«. Ist der Hang zu Sprachregelungen etwas spezifisch Deutsches? Ist es der Hang, allem Ausländischen nachzubeten, wenn es sich den Anschein des Siegreich-Zeitgemäßen zu geben weiß? Ist diese Unselbständigkeit des kulturellen Empfindens etwas eigentümlich Deutsches? Oder wäre, in dritter Stufe, der manische Hang zur Selbstkritik bis zur Selbstherabsetzung, ja zum Selbsthaß das spezifisch Deutsche?

Die Deutschmaschine lebt: Friedrich Dieckmanns Nationalfarben
Der Spott ist bekannt: Deutsch sein heißt, andauernd zu fragen, was deutsch ist. Friedrich Dieckmanns italienische Gewährsfrau kennt ihn auch. Für sie ist er billig zu haben, denn alle anderen Europäer können ihr nationales Adjektiv unbefangen auf stammes- oder landschaftsgeschichtliche Ursprünge zurückführen. Ihnen klingt schon das Wort deutsch kurios, so nennen sie uns nach ihrer Gewohnheit lieber Germanen oder Alemannen. Die Slawen allerdings sahen uns aus unliebsamer Begegnung als die Fremden schlechthin. Unsere Sprachhistoriker können uns aber auch nicht verläßlich sagen, was deutsch sein bedeuten könnte. Von "teutonisch" kommt es jedenfalls nicht, und neuerdings steht sogar in Frage, ob das westgermanische "theodisk" (allgemein "zum Volke gehörig") für den späteren Gebrauch des Wortes etwas zu besagen hat.
Manch einer, der sich um die nationale Identität sorgte, wollte aus dieser Unbestimmtheit den Schluß ziehen, deutsch sein sei von alters her Bindungslosigkeit. Rudolf Borchardt sah den Deutschen als ruhelosen "Wanderer seiner Geschichte" und als landlosen "Gast auf Erden", und selbst Walter Benjamin beklagte "die offenkundige Verlassenheit der besten Deutschen, die einer gleichgestimmten Umwelt, einer volkhaften gefügten Perspektive ins Vergangene" entbehrten. Eine solche Verlassenheit scheint auch Friedrich Dieckmann zu fürchten, schon sieht er die von Fritz Stern in der Weimarer Republik diagnostizierte "verbitterte Zerrissenheit" der Deutschen wieder zur Nationaleigenschaft werden. Die Frage nach dem Verbindenden sei, wo nun auch noch die deutsche Mark weggefallen sei, einmal wieder dringlich.
Der Kern seiner noblen Antwort steht in der Tradition von Schriftstellern und Denkern, die sich wie Rudolf Borchardt, Hugo von Hofmannsthal oder Theodor W. Adorno mit der nationalen Identifikation schwertaten und rassistische Prägungsvorstellungen ablehnten. "Dieses medial Verbindende ist die deutsche Sprache. Sie konstituiert deutsche Nation, deutsche Kultur in einem fundamentalen Sinn." Die deutsche Sprache trotz Rechtschreibreform "rein und geschmeidig zu erhalten" sei daher die aktive und zukunftsträchtige Antwort auf die Frage, was deutsch sei. Das ist die approbierte Auskunft des nachdenklichen Schriftstellers, die allerdings auf eine mehr oder minder elitäre Zugangskontrolle, auf ein ziemlich geheimes Deutschland hinausläuft. Merkwürdig nur, daß Dieckmann gleichzeitig meint, die Geographie sei das Schicksal. Dieses habe es in den neunziger Jahren gut mit Deutschland gemeint, das nach den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts endlich "die Entelechie seiner kontinentalen Zentrallage verwirklicht" habe und sich nunmehr von lauter Freunden umgeben sehe.
Diejenigen, die mehr oder weniger Deutsch können und sich für deutsche Kultur weniger interessieren, halten sich aber lieber ans sinnlich Wahrnehmbare und, wie unlängst wieder deutlich wurde, die Freunde ringsum auch. Blond oder schwarz, Spaghetti oder Kartoffeln, Bier oder Wein, der deutsche Wald oder die blaue Küste, Birkenstock-Sandalen oder modische Halbschuhe sind eben anschaulichere Merkmale. Dieses Spiel mit nationalen Stereotypen überläßt Dieckmann vornehm den herbeizitierten ausländischen Mitbürgern. Die Ergebnisse sind ausgewogen. Den Deutschen fehlt es an Wärme und Humor, sie sind aber diszipliniert und kümmern sich um ihre Kinder. Stur sind sie und haben immer Angst, sich zu blamieren. "Sie nehmen sich zu ernst und müssen alles idealisieren." Nüchtern sind sie aber auch und sogar toleranter als die anderen Europäer.
Eine schöne Wortbildung stammt von einer Russin: "einkonserviert" seien sie, das gefällt auch dem Sprachpuristen. Was Dieckmann an den Antworten am meisten zu interessieren scheint, ist die Kritik an der deutschen Weigerung, auch einmal stolz auf das eigene Land zu sein. So geht es ihm in seinen Beiträgen immer wieder um den Einspruch gegen die Herausbildung einer "Negatividentität". Europa sei nämlich nur als ein "Verbund selbstbewußter Nationen" zu denken.
Ernst und idealistisch sieht Dieckmann seine Aufgabe in der Beförderung einer besonnenen Vaterlandsliebe, die sich im Sinne Schillers als Arbeit "an dem ewgen Bau der Menschenbildung" ausprägen soll, und im Widerstand gegen eine weitere Aushöhlung der nationalen Souveränität. Gegen den zerstörerischen Einfluß der Globalisierung und ihrer Unterhaltungsindustrie sei die nationale Hochkultur zu pflegen. Viel geistige und physische Beweglichkeit seien doch in der deutschen Gesellschaft anzutreffen, und auch an Solidarität fehle es, siehe Elbeflut, nicht. Und doch treibt Dieckmann selbst die Suche nach einem positiven Deutschland-Bild und einem verbindlichen Begriff seit Jahren beinahe unverändert um. In seiner Bestimmungsnot greift er schon einmal zu einem Schulbuch aus dem neunzehnten Jahrhundert, um dort nur wieder die alte Tautologie zu finden: "Ein Volk ist eine Gesamtheit von Menschen, die einerlei Sprache sprechen, ich gehöre dem deutschen Volke an."
Überhaupt muten Dieckmanns Einlassungen gelegentlich auf betuliche Weise neudeutsch religiös-patriotisch an. Die einzelnen Beiträge mögen je eine anregende Wirkung gehabt haben, in der Massierung und Wiederholung gehen sie einem zunehmend auf die Nerven. Am Ende des Büchleins hat der Leser mehrere hundert Male "deutsch" und "Deutschland" gelesen, und da geht es ihm wie Alexander Kluge und Oskar Negt in "Geschichte und Eigensinn". Ihnen kam in der intensiven Betrachtung der Buchstabenfolge Deutschland die Wahrheit eines Diktums von Karl Kraus vor Augen: Je näher man ein Wort anschaut, desto ferner schaut es zurück.
FRIEDMAR APEL
Friedrich Dieckmann: "Was ist deutsch?" Eine Nationalerkundung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 228 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Friedrich Dieckmanns "Nationalerkundung" über das, was heute noch deutsch genannt werden kann, blickt nach Ansicht des "lx." zeichnenden Rezensenten auf ein "Land im Dämmerschein". Schließlich seien die alten Deutschlandbilder abgegriffen, das Land Goethes sei längst unter Verdacht geraten, die Bilder von einem "neuen" Deutschland führen den Geist eh auf Irrwege. Dennoch scheinen Dieckmann einige spezifisch deutsche Eigenheiten einzufallen, etwa die deutsche Benennungspedanterie. Wörter wie Papierabfall, rezyklierbarer Abfall, Restmüll etwa zeugen für Dieckmann von einem terminologischen Gleichschaltungsdruck, der als linguistic correctness laufen könne und der mittlerweile ein eigenständiges Pendant zur amerikanischen political correctness darstelle, referiert der Rezensent. Er hebt hervor, dass Dieckmann um die Schwierigkeit, sich als Deutscher in der eigenen Haut wohl zu fühlen weiß. "Es ist das depressive Verhältnis zum kollektiven Selbst", analysiert der Rezensent, "das ihn diese Erkundungen - auch zurück zur ehemaligen DDR-Literatur - machen lässt."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH