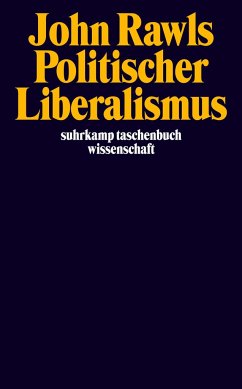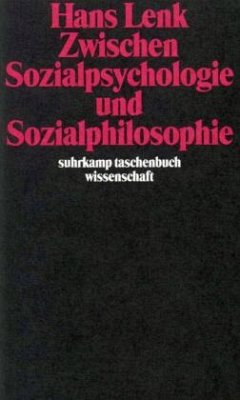Was ist Gleichheit?
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
15,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ronald Dworkin ist einer der herausragenden Philosophen, dessen Arbeiten zum Egalitarismus nur noch durch das Werk von John Rawls übertroffen werden. Mit Was ist Gleichheit? liegen nun zentrale Texte Dworkins erstmals in deutscher Sprache vor. Sie entwickeln eine Theorie der Ressourcengleichheit, der zufolge eine Gesellschaft dann gerecht ist, wenn in ihr alle Ressourcen gleich verteilt sind. Dies bedeutet für Dworkin nicht, daß alle Menschen das gleiche Niveau an Wohlstand oder Lebenszufriedenheit erlangen können oder daß dies überhaupt wünschenswert wäre. Zwar sollte ein Staat indivi...
Ronald Dworkin ist einer der herausragenden Philosophen, dessen Arbeiten zum Egalitarismus nur noch durch das Werk von John Rawls übertroffen werden. Mit Was ist Gleichheit? liegen nun zentrale Texte Dworkins erstmals in deutscher Sprache vor. Sie entwickeln eine Theorie der Ressourcengleichheit, der zufolge eine Gesellschaft dann gerecht ist, wenn in ihr alle Ressourcen gleich verteilt sind. Dies bedeutet für Dworkin nicht, daß alle Menschen das gleiche Niveau an Wohlstand oder Lebenszufriedenheit erlangen können oder daß dies überhaupt wünschenswert wäre. Zwar sollte ein Staat individuell unabwendbare Unglücksfälle zu kompensieren suchen, es ist aber nicht seine Aufgabe, die Vor- und Nachteile zu egalisieren, die sich aus eigenverantwortlichen Entscheidungen ergeben. Gerechtigkeit, so Dworkins zentrale These, erfordert vor allem eine gleiche Ausgangsposition für alle.