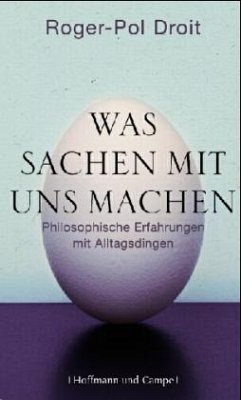Haben Sie schon bemerkt, dass ein Schlüsselbund von Liebe sprechen kann? Wussten Sie, dass eine Waschmaschine mitunter von Seelenwanderung erzählt und der Einkaufswagen von der Verwirrung der Gefühle? Schauen Sie sich um! Sie sind nicht nur von menschlichen Wesen umgeben. Heute gibt es mehr Dinge auf der Welt als jemals zuvor. Im gleichen Maße, wie sie sich vermehren, nehmen wir sie nicht mehr wahr.
Darum: Machen Sie philosophische Erfahrungen mit den Dingen des Alltags, erleben Sie die Revolution des Staubsaugers! Mit Aufmerksamkeit, einem gewissen Humor und etwas Verrücktheit werden Sie einen Weg entdecken, die Welt mit neuen Augen zu sehen!
Darum: Machen Sie philosophische Erfahrungen mit den Dingen des Alltags, erleben Sie die Revolution des Staubsaugers! Mit Aufmerksamkeit, einem gewissen Humor und etwas Verrücktheit werden Sie einen Weg entdecken, die Welt mit neuen Augen zu sehen!
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Andreas Bernard lässt kein gutes Haar an diesen kurzen Texten mit philosophischem Anstrich, die ihn etwas ungehalten gemacht haben. Das Thema Alltag ist seiner Meinung nach schon längst zu einer "etwas überstrapazierten Kategorie der Essayistik" geworden, und wenn, dann müsse man es machen wie seinerzeit Roland Barthes: mit "schriftstellerischer Strenge" und einem Ich als "diskreten Vehikel einer Reflexion". Das Ich von Roger-Pol Droit dagegen, stellt Bernard fest, ist schwatzhaft, eitel und schwadronierend. Anstatt die ganz brauchbaren Ansätze der theoretischen Zwischentexte umzusetzen, in denen ein Projekt der Klassifizierung von Dingen anhand ihrer gegenwärtigen Beziehung zum Menschen entworfen wird, "gibt es seine Vorlieben zum Besten". So erfahre man wenig über die "Erscheinungsweise der Dinge", dafür aber alles, was man nicht wissen wolle über das "leidlich interessante Leben" eines Pariser Intellektuellen mit einem "Faible für Gartenarbeit und Heimwerkertum". Erkenntnisgewinn, so Bernard, bleibt bei diesem redundanten Bombardement mit Binsenweisheiten, "simpler Kulturkritik" und onkelhaften Pointen aus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH