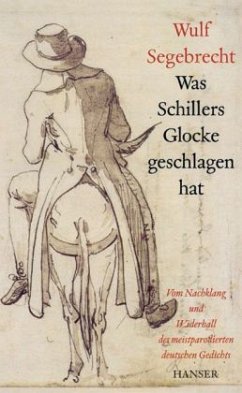Schiller zu parodieren war bereits zu seinen Lebzeiten eine beliebte Beschäftigung und ist es bis heute geblieben. Wulf Segebrecht hat einige der schönsten Verunglimpfungen aus der Geschichte des Lieds von der Glocke ausgewählt. Böse Verballhornungen stehen neben ernsthaften Ehrerweisungen, ideologiekritische Umarbeitungen neben witzigen Nonsens-Versen. Garantiert nicht zum sturen Auswendiglernen, sondern zum puren Vergnügen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wolfgang Schneider stellt "einen der amüsantesten Beiträge zum Schillerjahr" vor: Wulf Segebrechts Wundertüte der Wirkungsgeschichte des, wie es im Untertitel heißt, "meistparodierten deutschen Gedichts". "Das Lied von der Glocke" wurde persifliert und veralbert, aufs Kuchenbacken und jegliches andere Handwerk übertragen, für schlüpfrige Herrenlyrik verballhornt und für politische Propaganda missbraucht. Und es wurde, so Schneider im Rückgriff auf den Autor, von anderen deutschen Dichtern - von Schlegel bis Enzensberger - immer wieder als minderwertig abgetan. Doch andererseits: "Eine Karikatur zieht herab. Hundert Karikaturen haben etwas von einer Hommage, sind ein Denkmal." Und so kann man in diesem Buch Schillers berühmtestes Gedicht als Urtext eines "lyrischen Geleitzug des bürgerlichen Zeitalters" neu kennen lernen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wulf Segebrecht lauscht dem Nachhall von Schillers "Glocke"
Schillers "Lied von der Glocke", Ende 1799 erschienen, ist ein vielfach verklärtes, vielfach verworfenes und auf jeden Fall das meistparodierte deutsche Gedicht. Seine ungeheure Popularität ist inzwischen allerdings historisch geworden. Zwar ist noch manches geflügelte Wort daraus im Umlauf; aber die große Mehrheit kann dieses Geflügel nicht mehr artgerecht bestimmen. Ein Gedicht von 430 Zeilen gilt heute als schwer vermittelbar.
Dabei ist das Lesen der "Glocke" eine kulturgeschichtliche Entdeckungsfahrt. Leitideen und alltagsbegleitende Sentenzen des neunzehnten Jahrhunderts können hier in Reinform studiert werden. Und die zahlreichen Nachdichtungen und Parodien, die Wulf Segebrecht in seinem Buch vorstellt, bilden einen lyrischen Geleitzug des bürgerlichen Zeitalters. Wirkungsgeschichte ist oft ein trockenes Kapitel; dies aber ist einer der amüsantesten Beiträge zum Schillerjahr.
Zehn symmetrisch gebaute achtzeilige Arbeitsstrophen, in denen es um die Herstellung der Glocke geht, wechseln in Schillers Gedicht mit den frei gestalteten Reflexionsstrophen, die Grundsituationen und Wechselfälle des menschlichen Lebens schildern, sofern es sich im Umkreis eines Glockenturms vollzieht. Allein die Zahl der Nachahmungen zeigt, wie ungemein sinnfällig das Verfahren, Konkretion und allgemeine Betrachtung zu amalgamieren, empfunden wurde. Andererseits hat die Parallelführung der Darstellungsebenen immer wieder Kritik hervorgerufen. Hans Magnus Enzensberger, Ende der sechziger Jahre Herausgeber einer provokativ glockenlosen Anthologie von Schillers Gedichten, lobte zwar den Glockengießerteil als gutinformierte Poesie eines Produktionsprozesses. Das übrige aber sei "schlechte Universalität" - und die "politischen Einsichten" Schillers seien schlicht nicht kommentarwürdig. Was allerdings ein unmißverständlicher Kommentar war.
Gewiß, die "Glocke" wurde oft als Vademecum bürgerlicher Hausvaterideologie verspottet. Andererseits ist es ein aus heutiger Perspektive geradezu verruchter Text, mit dessen vollmundigen Geschlechterklischees man Gleichstellungsbeauftragte zum Ohnmachtsanfall treiben könnte: "Und drinnen waltet / Die züchtige Hausfrau." Dieses Familienidyll - so Segebrecht - ist jedoch kein Ausdruck von Biedersinn; es ist vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Kriegs- und Revolutionsangst zu verstehen, die in den vielleicht gelungensten Passagen des Gedichts thematisiert wird.
Immerhin wirkten die von Schiller beschworenen Geschlechterverhältnisse bereits auf manche Zeitgenossen antiquiert. Die Schlegels wollen beim Lesen des Gedichts bekanntlich vor Lachen vom Stuhl gefallen sein. Während für Schiller das Sittliche das Erhabene war, sah Friedrich Schlegel in der "Glocke" das Sittliche mit dem Platten zusammenfallen - eine unerhörte Verbindung des Idealen mit dem Gemeinen. Bei allem Lob der Volkstümlichkeit: Das war den Romantikern dann doch zu populär.
August Wilhelm Schlegel übte sich darüber hinaus in technischen Einwänden: Im Gedicht sei zwar weitschweifig von der Glocke, aber an keiner Stelle vom Klöppel die Rede. Das kleine Versäumnis Schillers wurde zu einem spöttischen Leitmotiv der Wirkungsgeschichte. "Gefährlich ist's, den Leu zu wecken, / verderblich ist des Nashorns Stoß, / Jedoch der schrecklichste der Schrecken, / Das ist die Glocke, klöppellos", reimte Alexander Mozkowski in einer der komischsten aller "Glocke"-Parodien.
Wulf Segebrecht scheint kein prinzipieller Freund solcher Scherze zu sein. Etwas verkniffen merkt er an: "Man macht sich lustig mit ihnen - auf Kosten anderer." Es geht um die Herabsetzung hehrer Vorbilder. "Auch hier ist der ,Witz' der Sache begrenzt", wendet er manchmal indigniert ein und spricht von Schillers "ehrwürdigem Gedicht". Um so lieber stellt er fest, daß viele der Parodien eigentlich eher freundliche Übernahmen sind. Sie sind keineswegs aggressiv und zersetzend, sondern wollen sich des "erfolgreichen, allseits bekannten und markanten Liedes zu ihren Zwecken bedienen". Kaum ein Berufsstand oder Verein, der sich nicht eine Selbsthuldigung mittels eines Preisgedichtes à la "Glocke" verschafft hätte. Etwa die Fotografen: "Aufgebaut aus Glas und Eisen / Steht das neue Atelier." Da gibt es ein "Lied vom Rocke", "Lied vom Buche" oder "Lied vom Theater". Im Lied vom "Civil-Proceß", verfaßt von Eduard von Seckendorff und bis heute oft nachgedruckt, werden Einzelheiten über die archetypische Richterlaufbahn mitgeteilt.
Andere Parodien widmen sich häuslichen Produktionsprozessen: sei es das Backen eines Brotes, eines Gugelhupfs oder, neuerdings, einer Pizza. So beginnt das "Lied von der Sandtorte": "Reich mit Butter ausgestrichen, / Steht die Form zum Kuchen dort." Auch "die Geburt des Menschen" wurde verglockt: "Vierzig Wochen sind geschwunden / Seit der große Akt geschah." "Von der Stirne heiß / Rinnen muß der Schweiß" - das paßt eben auch zum Wehengeschehen. Für das Herrenzimmer wurden pornographische Verballhornungen geschrieben, die manchem Bildungsbürger die Lizenz zum Unerhörten gaben. Auch politisierende Varianten sind zahlreich vertreten. M. Reymonds "Lied von der Kanone" (1881) ist eine Einübung in stramm nationales und militaristisches Verhalten: "Gefährlich sind die Liberalen, / bedenklich jeder Civilist, / Jedoch der Schrecklichste von allen, / Das ist der rothe Socialist."
Auf der anderen Seite gab es Parodien gegen Willkür-Justiz und Zensurmaßnahmen. Die "Glocke"-Nachahmungen spiegeln die Radikalisierung der politischen Verhältnisse in der Kaiserzeit. Berüchtigt wurde Eduard Schwechters "Lied vom Levi", das die "Glocke" zu antisemitischen Zwecken mißbrauchte. Arthur Wohlgemuth wendete das Muster auf die Schützengraben-Wirklichkeit des Ersten Weltkriegs an ("Der Unterstand", 1916). Ein Jahr später erschien das "Lied von der 7. Kriegsanleihe": "Fest gemauert in der Erden / Steht die Front in West und Ost", lauten die ersten Zeilen.
Eine Karikatur zieht herab. Hundert Karikaturen haben etwas von einer Hommage, sind ein Denkmal. Im "Wallenstein" zögert Schiller den Auftritt des Feldherrn hinaus, läßt nicht ihn selbst, sondern über ihn reden. Und je mehr geraunt und erzählt wird über Wallenstein, desto größer erscheint er, desto mehr lädt sich das schweigende Zentrum mit Bedeutung auf. Einen ähnlichen Effekt zeitigt dieses Buch: Je mehr imitiert, persifliert und parodiert wird, desto mehr von seiner Größe gewinnt das sagenhafte Original, Bezugspunkt all dieses Reimens und Raunens, zurück. Ein Text, der die literarische Phantasie der Deutschen in solcher Intensität besetzt und stimuliert hat - der muß wohl erhaben sein.
WOLFGANG SCHNEIDER
Wulf Segebrecht: "Was Schillers Glocke geschlagen hat". Vom Nachklang und Widerhall des meistparodierten deutschen Gedichts. Carl Hanser Verlag, München 2005, 176 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main