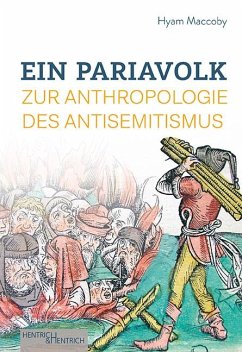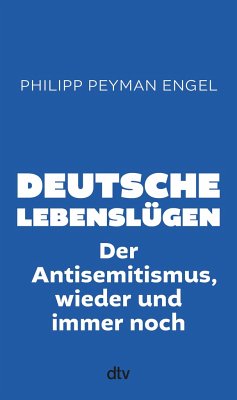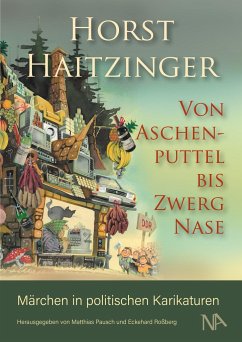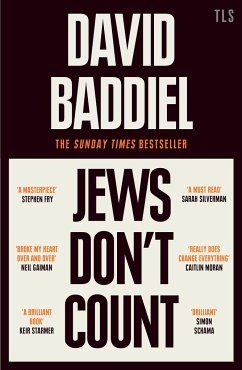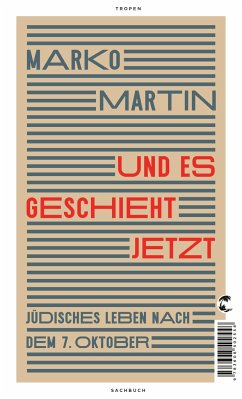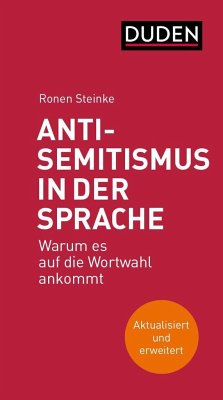Nicht lieferbar

Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?
Über den Antisemitismus im Alltag
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Antisemitismus hat viele Gesichter - und die meisten davon sind sehr freundlich. Doch auch die besten Manieren schützen nicht davor, Unsinn zu glauben. Wie zum Beispiel, dass alle Juden große Nasen hätten. Oder gut mit Geld umgehen könnten.Der Schweizer Schriftsteller Thomas Meyer wurde nie verprügelt, weil er Jude ist. Aber viele Male verspottet, beleidigt und mit irrwitzigen Behauptungen konfrontiert. Wie zum Beispiel, dass seine Nase typisch jüdisch sei. Widersprach er, widersprach man ihm: Doch, doch, das sei eindeutig eine jüdische Nase. Genau so sähen die aus! Irgendwann hörte e...
Antisemitismus hat viele Gesichter - und die meisten davon sind sehr freundlich. Doch auch die besten Manieren schützen nicht davor, Unsinn zu glauben. Wie zum Beispiel, dass alle Juden große Nasen hätten. Oder gut mit Geld umgehen könnten.Der Schweizer Schriftsteller Thomas Meyer wurde nie verprügelt, weil er Jude ist. Aber viele Male verspottet, beleidigt und mit irrwitzigen Behauptungen konfrontiert. Wie zum Beispiel, dass seine Nase typisch jüdisch sei. Widersprach er, widersprach man ihm: Doch, doch, das sei eindeutig eine jüdische Nase. Genau so sähen die aus! Irgendwann hörte er auf zu diskutieren und begann, seine Erlebnisse mit dem alltäglichen Antisemitismus aufzuschreiben.Entstanden ist ein kompakter Essay mit großer Wirkung. Die Alltäglichkeit und die oft erschreckende Direktheit von Meyers antisemitischen Erlebnissen nimmt uns als Leserinnen und Leser voll in die Pflicht. Und Meyer schont auch sich selbst nicht, denn er geht seinen eigenen Ressentiments in diesem bewegenden Text ebenso auf den Grund. Meyers Essay ist ein radikal subjektiver, persönlicher Beitrag zur Antisemitismus-Debatte - ein dichtes Buch mit großer Sprengkraft.Und seine Nase ist ganz normal, übrigens.