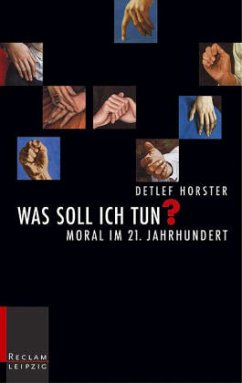Welche Konsequenz hat der Bedeutungsverlust des christlich geprägten Moralbegriffs? Lassen sich in der modernen Gesellschaft noch moralische Regeln mit universaler Geltung finden, die für alle verbindlich und gültig sind? Auf diese aktuelle Fragen versucht Horster eine Antwort zu geben. Er entwirft eine Theorie, die nah am Alltag mit seinen moralischen Fragen, Problemen und Entscheidungen angesiedelt ist.
"Ständig trifft der Mensch moralische Entscheidungen, und zwar oft, ohne dass er es merkt. Doch er will nicht mit Moral belästigt werden. Moralphilosophen haben es nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Nun versuchen zwei Philosophieprofessoren, mit ihren Büchern das Image der Moral zu verbessern. Was soll ich tun, möchte der in Hannover lehrende Detlef Horster wissen. Warum überhaupt moralisch sein?, fragt sein münsterscher Kollege Kurt Bayertz.
Beiden geht es um die Praxis, beide bieten in ihren Büchern eine Fülle von alltäglichen Situationen, Beispiele auch, in denen besseres Wissen und Handeln auseinander gehen: wenn wir etwa die für richtig erachtete Mülltrennung wegen schlechten Wetters nicht praktizieren. Bei Bayertz und Horster wird keine Keule geschwungen. 'Moralphilosophen', schreibt Horster, 'können keine Ratschläge für Entscheidungen im Einzelfall geben.' Aber immerhin sind sie in der Lage, die Entscheidungssituationen scharf herauszuarbeiten."
Der Spiegel
"Moralphilosophen neigen zur Wirklichkeitsferne. Ihr Geschäft besteht vielfach darin, vertraute Alltagssituationen so lange mit Theorien zu traktieren, bis jeder Realitätsbezug abhanden gekommen ist. Dagegen hat sich der hannoversche Sozialphilosoph Detlef Horster das Ziel gesetzt, im Ausgang von 'moralischen Alltagskonflikten' Lösungen zu thematisieren, die ihren Bodenkontakt behalten. Horsters Position ist der 'moralische Realismus'. Danach beruhen moralische Regeln nicht auf persönlichen Präferenzen, sondern auf objektiven Gründen. Deren normativer Hintergrund bilden universelle Werte, die aus der jüdisch-christlichen Tradition hervorgegangen sind und bis in die Gegenwart ihre Gültigkeit behalten haben."
Die Zeit
Beiden geht es um die Praxis, beide bieten in ihren Büchern eine Fülle von alltäglichen Situationen, Beispiele auch, in denen besseres Wissen und Handeln auseinander gehen: wenn wir etwa die für richtig erachtete Mülltrennung wegen schlechten Wetters nicht praktizieren. Bei Bayertz und Horster wird keine Keule geschwungen. 'Moralphilosophen', schreibt Horster, 'können keine Ratschläge für Entscheidungen im Einzelfall geben.' Aber immerhin sind sie in der Lage, die Entscheidungssituationen scharf herauszuarbeiten."
Der Spiegel
"Moralphilosophen neigen zur Wirklichkeitsferne. Ihr Geschäft besteht vielfach darin, vertraute Alltagssituationen so lange mit Theorien zu traktieren, bis jeder Realitätsbezug abhanden gekommen ist. Dagegen hat sich der hannoversche Sozialphilosoph Detlef Horster das Ziel gesetzt, im Ausgang von 'moralischen Alltagskonflikten' Lösungen zu thematisieren, die ihren Bodenkontakt behalten. Horsters Position ist der 'moralische Realismus'. Danach beruhen moralische Regeln nicht auf persönlichen Präferenzen, sondern auf objektiven Gründen. Deren normativer Hintergrund bilden universelle Werte, die aus der jüdisch-christlichen Tradition hervorgegangen sind und bis in die Gegenwart ihre Gültigkeit behalten haben."
Die Zeit

Detlef Horster möchte mit der Frage danach, was man tun soll, erst einmal direkt vor Ort gehen
"Mein Buch hat unendlich viele Diskussionen ausgelöst." Insbesondere habe ihm dabei zu denken gegeben, daß in den allermeisten vorgebrachten Fällen moralischer Entscheidungen, die doch den Prüfstein jeder Moralphilosophie bildeten, der Bezug auf ein monistisches Prinzip, wie bei ihm das Prinzip der wechselseitigen Anerkennung, nicht weiterhilft. Deshalb "mußte ich mein Konzept der ersten Ausgabe meiner ,Postchristlichen Moral' ändern." In seinem neuen Buch möchte Detlef Horster noch näher an die moralische Lebenswirklichkeit rücken, die auch die Wirklichkeit seiner Leser ist. Historisch gibt ihm die Herkunft der abendländischen Werte aus der christlichen Tradition den Beleg, daß es objektive Werte gibt, die universell gelten. Systematisch nimmt er William D. Roß als Gewährsmann für eine Common-sense-Theorie der Moral. "Die Auffassung, daß man erst eine intersubjektive Übereinstimmung herbeiführen muß, kann nicht richtig sein, denn wir befolgen die moralischen Verbote in unserem Alltag, ohne zu prüfen, ob wir uns denn dazu selbstverpflichtet hätten."
Da geht einiges durcheinander. Zwar müßte man historisch desinteressiert oder dogmatisch verblendet sein, um die christliche Herkunft der abendländischen Werte zu übersehen. Trotzdem ist die Tatsache, daß das Abendland in einem christlichen Wertehorizont steht, kein moralphilosophischer Beweis für die Universalität dieser Werte. Horster selbst nimmt einen Kongolesen zum zentralen Beispiel, der seinen Vater in der Heimaterde begraben will. Auch ist es immer wieder nützlich, darauf hinzuweisen, daß die meisten Menschen sich in den meisten Situationen moralisch korrekt verhalten oder doch ein genaues Bewußtsein davon haben, was ein korrektes Verhalten wäre. Trotzdem kann das moralische Verhalten keinen Einwand gegen Intersubjektivitätstheorien abgeben. Die behaupten nicht, daß jedem Handeln eine Diskussionsrunde voranzugehen habe, sondern nur, daß wir mit dem Handeln den Anspruch verbinden, die Regeln dieses Handelns gegen Einwände verteidigen zu können.
Horster hat einen unsinnigen Begriff von Begründung. Die moralphilosophische Prinzipienlehre, auch seine frühere eigene, kritisiert er, weil sie vor Ort nicht weiterhilft. Doch man mag Moralphilosophie für noch so überflüssig halten, kein Moralphilosoph will mit seinen Begründungen Bösewichter überzeugen oder auch nur Entscheidungen deduzieren. In moralphilosophischen Begründungen geht es vielmehr darum, zu verstehen, was wir tun, wenn wir moralisch handeln oder urteilen. Nicht zuletzt darin liegt ein christliches Erbe. Galt es doch Anselm schon ganz am Anfang der christlichen Philosophie für eine Nachlässigkeit, das, was wir glauben, nicht auch einsehen zu wollen. Bei Horster dagegen wird das Mittelalter, mit Luhmann von der immer komplexer werdenden Moderne abgegrenzt, zu einer Art von sittlichem Naturzustand und das Christentum zu blindem Traditionalismus.
Im übrigen bleibt das Hinanrücken an den moralischen Alltag bloßes Programm. Die Ausführung schickt uns durch die weite Landschaft all dessen, was heute so im Zusammenhang von Moral diskutiert wird. Auf 132 großzügig bedruckten Seiten werden 162 Werke extensiv und oft mehrfach zitiert. Horster sagt uns zu allem seine Meinung. Man kann diese Meinung teilen und das Resultat dennoch unersprießlich finden. Die mikroskopischen Abgrenzungen gegen andere Professoren sind wohl nur für wenige nachvollziehbar.
Umgekehrt muß nicht durch die obendrein einzige Abbildung des Bandes belegt werden, daß im Mittelalter "alle an einem Ort waren, alle dasselbe wußten und alle, wenn überhaupt etwas, einzig die Bibel gelesen hatten". Wo aber der "undatierte Plan der Stadt Kempen" schon einmal da ist, kann man ihm auch entnehmen, daß die Vorstellung von der "gewachsenen mittelalterlichen Stadt" und den heutigen "gleichgeordneten Planquadraten" ohnehin nicht viel taugt. Auf den ersten Blick ist das Wegeraster von Kempen als Resultat klarer Planung zu erkennen. So ist selbst Horster noch in Deduktionen aus Prinzipien befangen.
Da aber, wo wirklich ein alternatives Begründungsprogramm zu suchen wäre, in einer Theorie der moralischen Gefühle, bricht er ab. "Bei der Verschränkung von moralischem Handeln, Motivation und Gefühl handelt es sich um einen komplexen Zusammenhang, der bislang erst rudimentär erforscht ist. Darum ist in dieser Hinsicht Zurückhaltung angezeigt."
GUSTAV FALKE
Detlef Horster: "Was soll ich tun?" Moral im 21. Jahrhundert. Reclam Leipzig Verlag, Leipzig 2004. 149 S., br., 9,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ralf Konersmann ist etwas irritiert. Detlef Horster wolle also Kants Frage - "Was soll ich tun?" - beantworten. Und zieht ein Kaninchen aus dem Hut, mit einem Gestus, als wäre das ein ganz neuer Trick, schimpft Konersmann, der die Argumentation so zusammenfasst: "Wo, wie beim Menschen, Instinkte fehlen, springen moralische Regeln ein, die sich, sofern die moralische Entwicklung gelingt, reflektieren und günstigenfalls bejahen lassen." Ein "moralischer Realismus" also: Der gesunde Menschenverstand bewahrt Werte, die aus dem Christentum stammen, und darauf kann man bauen. Doch Moment mal: Was ist denn, fragt der Rezensent baff, mit den Menschen, die mit den Christentum nichts am Hut haben? Und überhaupt: Kann man denn christliche Werte einfach als ethische Normen interpretieren? Vor allem aber: Was ist mit der "Eigenständigkeit und Legitimität der Neuzeit"? Aber wenn Horster meint, Kants Frage beantwortet zu haben ...
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH