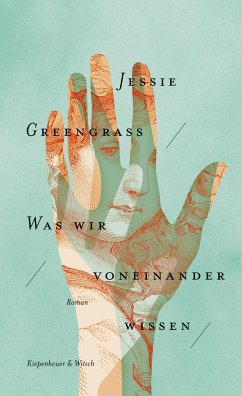Ein philosophischer Roman über die Frage, wie man Erkenntnisse gewinnt und die richtigen Entscheidungen trifft.
Eine junge Frau steht vor einer lebensverändernden Entscheidung und stellt sich deshalb die Frage, wie man eigentlich Erkenntnisse gewinnt. Sie überdenkt ihre eigene Situation und die ihrer Mutter und Großmutter, betrachtet aber auch die Erfolge berühmter Wissenschaftler, um so zu verstehen, was das Leben eigentlich ausmacht und wie man voneinander lernen kann. Will ich ein Kind? Will ich es jetzt? Was gibt dem Leben Bedeutung? Die Ich-Erzählerin versucht, im Leben ihrer verstorbenen Mutter und ihrer Großmutter, die Psychoanalytikerin war, Antworten auf diese essenziellen Fragen zu finden. Auf der Suche nach einem Muster, das sich auf ihr eigenes Leben übertragen lässt, nimmt sie Wendepunkte im Leben wichtiger Persönlichkeiten der Medizingeschichte in den Blick: Röntgen und seine Entdeckung der X-Strahlen, Sigmund und Anna Freud und ihre Entwicklung der Psychoanalyse sowie John Hunter, der die Anatomie erforschte. Wie fällt man rationale Entscheidungen, wenn man die emotionalen Konsequenzen nicht absehen kann? Kann man aus der Geschichte und den Errungenschaften anderer lernen und für das eigene Leben Schlüsse ziehen? Die Autorin, für ihre Erzählungen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erkundet in ihrem ersten Roman auf höchstem Niveau die Angst, folgenreiche Fehler zu machen.
Eine junge Frau steht vor einer lebensverändernden Entscheidung und stellt sich deshalb die Frage, wie man eigentlich Erkenntnisse gewinnt. Sie überdenkt ihre eigene Situation und die ihrer Mutter und Großmutter, betrachtet aber auch die Erfolge berühmter Wissenschaftler, um so zu verstehen, was das Leben eigentlich ausmacht und wie man voneinander lernen kann. Will ich ein Kind? Will ich es jetzt? Was gibt dem Leben Bedeutung? Die Ich-Erzählerin versucht, im Leben ihrer verstorbenen Mutter und ihrer Großmutter, die Psychoanalytikerin war, Antworten auf diese essenziellen Fragen zu finden. Auf der Suche nach einem Muster, das sich auf ihr eigenes Leben übertragen lässt, nimmt sie Wendepunkte im Leben wichtiger Persönlichkeiten der Medizingeschichte in den Blick: Röntgen und seine Entdeckung der X-Strahlen, Sigmund und Anna Freud und ihre Entwicklung der Psychoanalyse sowie John Hunter, der die Anatomie erforschte. Wie fällt man rationale Entscheidungen, wenn man die emotionalen Konsequenzen nicht absehen kann? Kann man aus der Geschichte und den Errungenschaften anderer lernen und für das eigene Leben Schlüsse ziehen? Die Autorin, für ihre Erzählungen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erkundet in ihrem ersten Roman auf höchstem Niveau die Angst, folgenreiche Fehler zu machen.

© BÜCHERmagazin, Ava Amira Weis
»Ein Roman von einer solchen Schwere und Schönheit, dass es einem teilweise den Atem verschlägt.« Bücher Magazin 20200822
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nicolas Freund diskutiert hier das zentrale Problem, mit dem sich dieser Roman befasst und das ein philosophisches ist, nämlich wie man den anderen verstehen kann. Er definiert es als Problem der Moderne, führt seinerseits Rilke und Gottfried Benn ins Feld, während die Protagonistin sich mehr mit Röntgen, Freud und dem Anatom John Hunter befasst, wie er schreibt, um den Blick ins Innere des Menschen zu tun. Über sie streut die Autorin, wie wir lesen, veritable Essays ein, um dann per Romanfigur, nämlich eine schwangere Frau, das Thema weiterzutreiben. Diese Vorgehensweise stellt vieles allzu unverbunden nebeneinander, findet der Kritiker. Gleichzeitig aber gefällt ihm, wie die Autorin die ganze Problematik feministisch wendet und zudem genau jene zentrale Arbeit, nämlich das Verstehen des anderen, immer wieder als Prozess ihren LeserInnen überlässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH