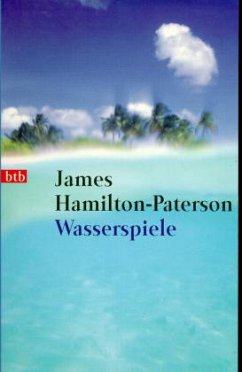Tiwarik heißt eine kleine, wasserlose Insel in Sichtweite der philippinischen Hauptinseln, wo James Hamiton-Paterson für einige Zeit seßhaft war. Mit der Insel hat es eine besondere Bewandtnis. "Ich habe auf Tiwarik gewartet", sagt der Autor und erzählt, wie er als Zwölfjähriger aus Langeweile während der Schulstunde die Karte einer Insel malte. Längst vergessen tauchte das Heft dreißig Jahre später zufällig auf. "Auf dem linierten Papier war eine Zeichnung der Insel Tiwarik, die ich selbst doch erst zwei Jahre zuvor entdeckt hatte!"

Jagen, essen, untergehen: James Hamilton Patersons "Wasserspiele" · Von Heinrich Wefing
James Hamilton Paterson ist ein Narr. Ein vierzigjähriger Narr mit Oxford-Abschluß, der auf einer philippinischen Insel namens Tiwarik haust, die exakt jenem imaginären Eiland gleicht, dessen Uferlinie er einst als Halbwüchsiger in ein Schulheft kritzelte. Hamilton Paterson ist ein Faulenzer, Herumtreiber und Sonderling, der sich von getrocknetem Fisch und Reis ernährt, der Brackwasser aus Plastikkanistern trinkt und mit Sperrholz-Flossen im Meer herumpaddelt.
Seine Kommilitonen von einst verlachen ihn, weil aus ihm kein respektabler Mittelklasse-Engländer geworden ist. Und seine neuen Nachbarn, die Filipinos, belächeln ihn, diesen europäischen Kauz, der so zu leben trachtet wie sie, aber nicht auf sein Schreibpult aus Bambusrohr verzichten mag, der ihre Sprache spricht, aber nicht versteht, daß ihr Sehnsuchtsort nicht Tiwarik heißt, sondern Manila. Die verslumte, verdreckte, abgasgeschwängerte Metropole der Päderasten und Prostituierten verspricht schnelles Geld und schnellen Genuß, all das also, was Hamilton Paterson hinter sich lassen will. So erweist sich Tiwarik, ein menschenleerer, wasserloser Felsbrocken, von Vulkanen ins Meer geschleudert, rasch als Fluchtpunkt einer sehr westlichen Perspektive: als pazifisches Mißverständnis.
Wie die Sammlung seiner naturhistorisch grundierten Reportagen, die vor zwei Jahren unter dem Titel "Seestücke" in Deutschland erschien, kreist auch Hamilton Patersons neues Buch "Wasserspiele" um das geographische Zentrum der philippinischen Inselwelt. Mit "Wasserspiele" legt der britische Journalist, der für die "Sunday Times" und das "Times Literary Supplement" schreibt, zudem Mitglied der "Royal Geographical Society" ist, jedoch ein wesentlich komplexeres Werk vor. So wie die zerklüfteten Korallenriffe, zu denen er immer wieder hinabtaucht, voller Leben stecken, so verbergen sich auch in seinem sehr persönlichen, gleichwohl unsentimentalen Text zahllose Sujets: Jugenderinnerung und Reisebericht, Essay und politisch korrekter Leitartikel, Handbuch für das Harpunenfischen und Anleitung zum Bau von Bambushütten. Wieder lotet Hamilton Paterson den ozeanischen Küstenraum aus, der sein Jagdrevier und seine Nahrungsquelle ist, vor allem aber eine vielschichtige Metapher für die fremde Welt, in der er zu versinken sucht.
Denn Hamilton Paterson ist kein Reisender von hier nach dort, kein gewöhnlicher zivilisationsmüder Aussteiger, der der Faszination des Fremden und Fernen erlegen ist. Seinen "Wasserspielen" fehlt völlig jene tropenfeuchte Schwüle, die etwa Bodo Kirchhoffs philippinischen Roman "Infanta" so süffig und auch ein wenig klebrig machte. Im Gegenteil, Hamilton Paterson wendet sich immer wieder vehement gegen jede Verklärung des Insellebens. Und doch flieht auch er vor den kalten Nebeln Londons, vor der Enge seiner Herkunft und der Aussicht, als Angestellter in einem Kleinwagen allabendlich im Stau zu stehen, nach einer Tasse Tee und der Ruhe im Reihenhaus dürstend. Aber Hamilton Paterson hat noch einen weiteren Grund, davonzulaufen: Ihn treibt der Wunsch, unterwegs verlorenzugehen.
Das Scheitern dieser Hoffnung beschreibt "Wasserspiele" sehr genau, trotz seines fatalistischen Tonfalls streckenweise sogar elegant. So sehr nämlich Hamilton Paterson hineinzugleiten versucht in jene andere Welt der Fischer und Taucher, Fallensteller und Vogeljäger, so sehr er seinen Leib, sein Leben von allem Ballast befreit, barfuß über seine Insel streift, ohne Uhr, ohne Zeitgefühl, im Einklang, wie er glaubt, mit Sonne und Mond, Wind und Wellen - in seinem Kopf schleppt er doch stets Bilder mit sich, deren er sich nicht entledigen kann: Die Hügelkette der Insel beschwört die Erinnerung an den fernen, immer fremd gebliebenen Vater herauf, dessen wohldosierte Sehnsucht nach Freiheit sich in Touren durch die norwegischen Berge erschöpfte. Und die Explosionen der Wasserbomben, mit denen die philippinischen Fischer ihr Handwerk zur profitablen Massenvernichtung rationalisieren, evozieren den Klang der Feuerwerkskörper seiner Kindheit, wiederholen den Lärm der Donnerschläge und Kracher inmitten englischer Vorgärten.
Doch der genarrte Hamilton Paterson kann über den Fehlschlag seines Experiments durchaus grimmig lachen. Zähneklappernd und kichernd zugleich sitzt er schließlich im Gras und entledigt sich eines dreißig Zentimeter langen Bandwurms, während der tropische Regen auf seinen Rücken trommelt: "Man bedenke seine kindische Entschlossenheit, allen angestammten Werten zu trotzen und sie umzukehren. Es kann kein Zufall sein, der einen Engländer auf eine unbewohnte Insel führt, auf der er zusieht, wie seine Darmparasiten aus ihm herausfallen und um seine Knöchel zappeln." Gerade in dieser betont britischen Ironie aber scheint auch der Zwiespalt des west-östlichen Reisenden auf, der sich vergeblich auf die Suche nach verlorenen Archipelen gemacht hat: "Irgend etwas fehlt mir, und dieser Zustand ist unheilbar."
,Wasserspiele" ist ein anrührendes Buch über Distanz und Nähe, über den Irrglauben, seine Welt verlassen zu können, indem man in die Ferne zieht. Der wunderbar komponierte Schluß übersetzt die Komik dieser vergeblichen Flucht, aber auch die offenkundige Tragik ihres Scheiterns in Bilder von großer Kraft. Ausgerechnet in der Tiefe des Meeres, nur durch eine dünne Nabelschnur aus Plastik mit Sauerstoff versorgt, umgeben von der unterseeischen Welt, deren Reichtum und Zauber er plastisch zu beschreiben weiß, wird Hamilton Paterson von seiner Herkunft eingeholt. Benommen von der Tiefe, verliert er die Orientierung, während ihn bildungsbürgerliche Assoziationen überfluten: ein leibhaftiger de Chirico taucht da plötzlich im trüben Blau auf, der sich über Schopenhauer und Nietzsche ausläßt, Zitate von William Burroughs, ein Gedicht Kiplings sprudeln aus symbolischen Abgründen empor. Statt sein Bewußtsein in nie gesehene Sphären zu erweitern, verfällt Hamilton Paterson in Halluzinationen des repetitierten Universitätswissens: Je heftiger er die Grenzen zu überschreiten versucht, je tiefer er eintaucht, um zwischen den Elementen wie zwischen den Welten hin und her zu wechseln, desto heimatloser wird er.
James Hamilton Paterson: "Wasserspiele". Aus dem Englischen übersetzt von Karin Meissenburg. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1997. 370 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main